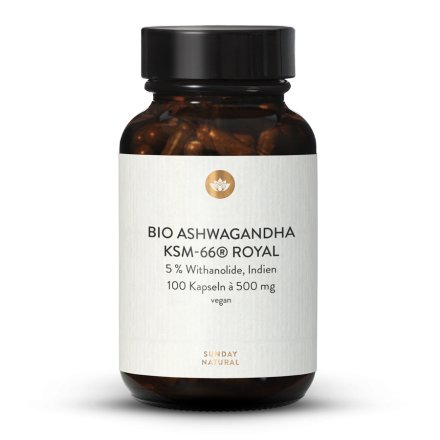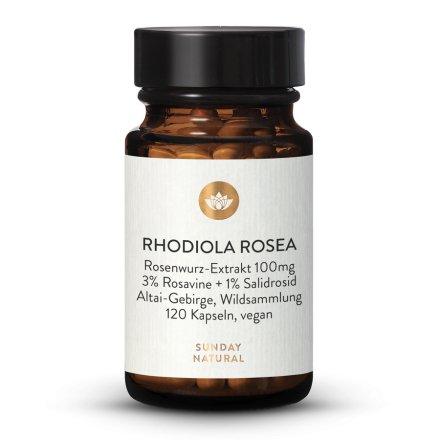Rückenschmerzen verstehen: Warum Körper und Kopf zusammengehören
Rückenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden in Deutschland – zwei Drittel der Menschen leiden regelmäßig darunter. Doch Schmerzen entstehen nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf. Catrin Marnitz, Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin, leitet die psychologische Abteilung im Rückenzentrum am Michel in Hamburg. Gemeinsam mit Tina Epking schrieb sie das Buch „Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache“. Im Podcast Healthwise erklärt sie, warum Schmerz ein „Imageproblem“ hat, wie Gedanken und Emotionen Beschwerden verstärken – und wie wir mit hilfreichem Denken, Bewegung und Selbstreflexion zu mehr Selbstwirksamkeit finden.
Schmerz verstehen: Alarmanlage des Körpers
- Akuter Schmerz schützt uns wie ein Feuermelder – er warnt bei Gefahr.
- Chronischer Schmerz hingegen funktioniert wie eine Fehlfunktion: Die Alarmanlage schrillt, obwohl nur ein „Teelicht“ brennt. Das führt zu Hilflosigkeit, Ängsten und Verspannungen.
Entscheidend ist zu verstehen: Schmerz entsteht erst im Gehirn, nachdem Signale bewertet und mit Erfahrungen abgeglichen wurden. Ohne Kopf kein Schmerz.
Stress, Glaubenssätze und Rückenschmerzen
- Stresshormone wie Cortisol verstärken langfristig Schmerzen und fördern Anspannung.
- Negative Glaubenssätze wie „Ich darf mich nicht bewegen“ oder „Meine Arbeit macht meinen Rücken kaputt“ halten Menschen in der Schmerzspirale fest.
- Katastrophisieren – also immer das Schlimmste erwarten – verschärft die Beschwerden.
Hilfreiches Denken heißt dagegen: objektiver auf die Situation schauen, realistische Bewertungen trainieren und kleine Handlungsschritte umsetzen.
Werkzeuge aus der Schmerzpsychologie
- Der Protektometer: Ein Analyse-Tool, das hilft, belastende („Danger in me“) und stärkende Faktoren („Safety in me“) zu erkennen und ins Gleichgewicht zu bringen.
- ABC-Modell: Gedanken (Beliefs) beeinflussen Gefühle und Verhalten – hilfreiches Umdenken kann Bewegung ermöglichen.
- Rituale und Bewegung: Kleine, regelmäßige Routinen wie Treppensteigen, Spazierengehen oder auf einem Bein Zähneputzen wirken nachhaltig.
- Selbstwert stärken: Positive Erfahrungen, gute Beziehungen und Selbstwirksamkeit senken Schmerzempfinden.
Praktische Take Aways
- Nicht alles glauben, was man denkt: Katastrophisieren entlarven und hilfreiche Gedanken üben.
- Bewegung fest einbauen: Kleine Schritte zählen – vom Spaziergang bis zur Kraftübung.
- Stress-Symptome beobachten: Anspannung, Schlafprobleme oder Grübelschleifen ernst nehmen.
- Dankbarkeit trainieren: Abends notieren, was gelungen ist – das ändert die Sichtweise.
- Rituale nutzen: Kleine Gewohnheiten (z. B. Balance beim Zähneputzen) stärken Körper und Geist.
Mehr erfahren im healthwise Podcast von sunday natural
Rechtlicher Hinweis
Dieser Artikel ersetzt keine ärztliche Beratung. Bei anhaltenden oder starken Schmerzen sollten Betroffene unbedingt medizinischen Rat einholen.
Produktempfehlungen von sunday natural
Catrin Marnitz ist eine deutsche Psychologin und Psychotherapeutin, die sich auf Rückenschmerzen und chronische Schmerzsyndrome spezialisiert hat. Sie arbeitet als leitende Psychologin im Rückenzentrum Am Michel in Hamburg und betont die enge Verbindung von Körper und Psyche: Rückenschmerzen werden oft durch Stress, Angst oder negative Denkmuster verstärkt. Marnitz setzt auf eine interdisziplinäre Therapie, bei der Psychologen, Ärzte und Physiotherapeuten gemeinsam mit den Betroffenen arbeiten. In ihrem Buch „Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache“ zeigt sie, wie Betroffene durch veränderte Denk- und Verhaltensweisen ihre Schmerzen besser bewältigen und zu einem aktiveren Alltag zurückfinden können.
"Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache", geschrieben von Catrin Marnitz: https://www.rowohlt.de/buch
130 Rückenschmerzen sind auch Kopfsache. Mit Catrin Marnitz
[Catrin Marnitz] (0:00 - 0:08)
Nee, und das hat ja auch so erst mal, ehrlich gesagt, auch ein schlechteres Image. Also wenn dir ein Orthopäde sagt, na ja, vielleicht sollten Sie mal zum Psychologen gehen. Was löst das in dir aus?
[Nils Behrens] (0:28 - 1:05)
Wir alle kennen das: Rückenschmerzen kommen oft genau dann, wenn das Leben sowieso schon schwer genug ist. Doch was, wenn nicht nur die Muskeln, sondern auch unsere Gedanken und Gefühle diese Schmerzen verstärken, oder sogar lösen können.
Catrin Marnitz ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und leitet die psychologische Abteilung im Rückenzentrum am Michel in Hamburg. Gemeinsam mit Tina Epking hat sie das Buch „Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache“ geschrieben. Ein Plädoyer für mehr Selbstwirksamkeit, weniger Angst vor Schmerz und den Mut, Körper und Geist gemeinsam zu betrachten.
Sie zeigt uns, warum Schmerz kein Feind ist und wie wir lernen können, ihn besser zu verstehen und zu beeinflussen. Und deswegen sage ich herzlich Willkommen, Katrin Marnitz.
[Catrin Marnitz] (1:05 - 1:06)
Hallo Nils.
[Nils Behrens] (1:06 - 1:09)
Catrin, wie rückenfreundlich war denn dein letzter Sonntag?
[Catrin Marnitz] (1:10 - 1:37)
Eigentlich rückenliebend. Ich war zum Zeitpunkt noch mit meinen beiden Töchtern im Urlaub. Und das heißt, ich hatte mit meinen Mädels, die sind 15 und fast 18, zehn Tage Quality Time außerhalb des Alltags.
Das war schon mal, glaube ich, ein Geschenk für beide Seiten. Wir haben stundenlang im Atlantik gebadet, mit den Wellen gekämpft, also uns viel bewegt. Im Anschluss habe ich mich hingelegt, habe ein spannendes Buch gelesen am letzten Sonntag.
Und ich glaube, es war ein perfekter Tag für meinen Rücken.
[Nils Behrens] (1:38 - 1:51)
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und vielleicht nur kurze Aufklärung, weil es so, man könnte denken, es sind zwei Kinder, aber es sind drei Kinder. Von daher sind es zwei 15 und eine 18.
Sehr gut. Dein Buch heißt „Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache“. Was meinst du damit ganz genau?
[Catrin Marnitz] (1:53 - 2:11)
Genau, was es heißt, dass, wenn wir über Schmerz reden oder Schmerzen behandeln, dass der Kopf nie auszuschließen ist. Es geht nicht ohne den Kopf. Also diese alte Diskussion, was ist rein psychisch, was ist rein körperlich, ist längst überholt.
Das heißt genau, wie wir früher gesagt haben, Leib und Seele gehören zusammen, gehört beim Schmerz immer Rücken und Kopf zusammen.
[Nils Behrens] (2:12 - 2:34)
Ich finde, jeder, der Kinder mal im Kindergartenalter hatte und wenn dann immer diese Aussage kam, oh, im Kindergarten sind wieder Läuse, dann merkt man in dem Augenblick, wie sofort das Kribbeln auf den Kopf anfängt. Also mir ging das zumindest immer so. Und ich finde, das ist für mich immer der Innbegriff von Psychosomatik.
Und ich glaube, wenn man dieses Beispiel nimmt, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch mit vielen anderen Teilen des Körpers so funktioniert.
[Catrin Marnitz] (2:34 - 2:39)
Das ist die Macht der Erwartung und die Aufmerksamkeitsfokussierung funktioniert super.
[Nils Behrens] (2:39 - 3:05)
Funktioniert super. Und ich finde auch tatsächlich, man kann das manchmal auch so beobachten, weil so je nachdem, wie man im Büro aufgestellt ist, dass man dann so sieht, wie, wenn irgendwas passiert oder auch wenn man jemanden anspricht mit was Negativem oder was Ernsthaftem, wie dann so auf einmal so diese Schultern schon so automatisch hochgehen. Ich finde, auch das ist etwas, was man sehr gut beobachten kann.
Also ja, du schreibst, Schmerz hat ein Imageproblem. Dann lass uns doch hier mal in die Imageberatung gehen. Warum ist es wichtig, den neu zu verstehen?
[Catrin Marnitz] (3:06 - 3:32)
Also Schmerz ist ja ganz viel verbunden mit Angst, mit Hilflosigkeit, mit sinkendem Leistungsvermögen. Das heißt, es ist ganz viel Kontrollverlust. Und wer hat schon Lust, mit einem negativen Image sich auseinanderzusetzen?
Das heißt, es ist wichtig, dass man versteht, was ist Schmerz eigentlich? Und wie ändert sich Schmerz auch, damit sich auch das Image ändern kann? Also man kann sich nur mit Dingen auseinandersetzen, glaube ich, die man auch versteht und dieses Image eben auch zu revidieren.
[Nils Behrens] (3:33 - 3:45)
Ja, also du sagst ja, akuter Schmerz schützt uns, während chronischer Schmerz uns eher lähmt. Was würdest du sagen, wie ist dein Zugang, das deinen PatientInnen zu erklären?
[Catrin Marnitz] (3:46 - 4:24)
Ich vergleiche das immer mit dem, was wir alle kennen, nämlich dem Feuermelder unter unseren Wohnzimmer- oder Schlafzimmerdecken. Wann geht der Feuermelder an? Wann soll er angehen, wenn es brennt?
So, dann schrillt ein lauter Ton. Macht total Sinn, um uns aufzurütteln, uns zu schützen. So, wenn man andauernde oder chronische Schmerzen hat, sprich nach drei Monaten, fängt das schon an.
Dann geht diese Alarmanlage schon los, wenn wir ein Teelicht anmachen. So, und dann werden wir mürbe. Wir werden, ja, antriebsarm.
Wir werden gelähmt. Nicht nur, weil wir das Teelicht angezündet haben, sondern weil uns dieser Ton buchstäblich auf die Nerven geht.
[Nils Behrens] (4:24 - 4:38)
Ja, ich nenne es ja immer so gern diese chinesische Tropfenfolter. Also hat man ja so den Kopf fixiert und es kommt nur mal ein Tropfen an die gleiche Stelle dann so. Und am Anfang denkt man ja, und?
Genau, dann nach ein paar Stunden, nach ein paar Stunden denkt man nicht mehr ja und.
[Catrin Marnitz] (4:38 - 4:42)
Irgendwann tut es übrigens auch weh, deswegen Folter Methode.
[Nils Behrens] (4:43 - 5:02)
Ja, ja, das ist in der Tat trotz allem. Lass uns noch mal wirklich. Ich möchte in diesen Punkt noch mal rein, dass du sagst, der Schmerz hat ein Problem, weil du hast es ja eben gerade gesagt.
Der Feuermelder soll uns schützen. Aber trotz allem möchte man ja Schmerzen generell vermeiden, oder?
[Catrin Marnitz] (5:04 - 5:24)
Ja, klar. Also Schmerz ist nützlich, aber er ist nicht unser Freund. Das heißt, dadurch, dass Schmerz ja ganz viel erst mal Negatives auslöst, weil wir uns negativ fühlen, ist das eine Sache, was ja auch in der Natur sinnvoll ist, dass wir ihn möglichst schnell wieder loswerden wollen.
Und das macht ja auch entsprechend Sinn, dass wir auch in dem Moment alles dafür tun, dass der Schmerz auch wieder weggeht.
[Nils Behrens] (5:25 - 6:23)
Bei mir ist es so, dass wenn ich länger nicht mehr gelaufen bin, also länger heißt bei mir fünf Tage oder sowas, dass ich dann manchmal auch merke, wenn ich so anfange, einfach kalt aus dem Bett aufzusteigen und dann loszulaufen, dass ein paar von meinen Gelenken dann erst mal so ein kleines bisschen brauchen, um sich reinzuruckeln. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein altes Phänomen, das hatte ich auch schon irgendwie mit Anfang 30, Ende 20, irgendwie so, dass man einfach wirklich merkt, man muss so ein bisschen in den Lauf reinkommen. Und da Schmerz zu sagen, ist vielleicht auch ein großes Wort dafür.
Aber trotz allem merkt man das dabei. Jetzt ist das ja quasi eine Art von akutem Schmerz, der dann aber im Laufe der Bewegung dann irgendwie weggeht. Jetzt kommen wir doch mal zu dem Rücken.
Wir reden jetzt ja, also kommen wir ja gleich nochmal ein bisschen stärker dann darauf, über die psychologische Komponente. Aber würdest du auch da sagen, dass man Schmerz auch eine Zeit lang erst mal, gerade wenn er so akut ist und dann von alleine wieder weggeht, auch erst mal wegignorieren kann?
[Catrin Marnitz] (6:24 - 6:54)
Es kommt darauf an, wie stark der Schmerz natürlich auch ist und was passiert ist. Also wenn du ganz plötzlich extrem starken Schmerz bekommst, dann macht es ja Sinn, erst mal wachsam zu werden und sich zu überlegen, okay, was kann das jetzt sein? Die Leitlinien sagen ja auch, wenn man länger als zwei Wochen Rückenschmerz hat, sollte man natürlich zum Hausarzt und in zweiter Instanz zum Orthopäden gehen.
Das heißt, ich würde es nicht ignorieren. Ich würde es aber auch nicht katastrophisieren. Aber die Frage ist ja, was passiert, wenn der Schmerz eben nicht wie zu erwarten von alleine wieder weggeht?
[Nils Behrens] (6:55 - 7:17)
Gut, aber dann sagen wir jetzt mal, ich bin dann, ich bin ehrlich gesagt jemand, der zugegebenermaßen sehr selten zum Hausarzt geht, weil ich gar keinen richtigen habe, sondern ich gehe dann immer so gewohnt direkt zum Spezialisten. Und dann würde ich jetzt eben halt bei euch zum Rückenzentrum am Michel dann einfach direkt gehen. Und jetzt würde ich ja behaupten, da lande ich wahrscheinlich erst mal beim Orthopäden.
[Catrin Marnitz] (7:18 - 8:01)
Also wenn du im Rückenzentrum anrufst und sagst, du hast seit längerer Zeit Schmerz, dann bekommst du den sogenannten Diagnostik-Tag. Das heißt, wir haben die Chance, dass wir dich eben interdisziplinär sehen könnten. Also eine Stunde setzt sich ein Orthopäde mit dir hin und bespricht die Struktur.
Das heißt, du bringst Bilder mit. Der untersucht dich. Der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin guckt sich die Funktion an, macht verschiedene Tests mit dir.
Und ich als Schmerzpsychotherapeutin schaue mir eben die psychosozialen Risikofaktoren an. Das heißt, wir beleuchten den Schmerz ganzheitlich und können dann eben gemeinsam besprechen, welche Risikofaktoren, welche Diagnostik liegt eigentlich vor und was entsteht da eigentlich für eine Behandlung draus?
[Nils Behrens] (8:02 - 8:40)
Weil das wäre genau, aber das hast du wahrscheinlich schon gesehen, da wollte ich ein bisschen mit meiner Frage hin, weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich zum Orthopäden gehe, ich habe in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, dass man auch durch eine falsche Ernährung oder eine Unverträglichkeit, dass da eben halt auch durch einen verkrampften Darm auch Rückenschmerzen entstehen können. Und sag dann immer als Beispiel, kein Orthopäde macht mit mir einen Ernährungstest oder fragt, wie ich denn so eigentlich normalerweise mich ernähre. Und genauso würde ich jetzt sagen, der Weg von Rückenschmerzen zur Psychotherapie ist jetzt ja nicht gerade etwas, was naheliegend ist in Deutschland.
[Catrin Marnitz] (8:41 - 9:25)
Nee, und das hat ja auch so erst mal ehrlich gesagt auch ein schlechteres Image. Also wenn dir ein Orthopäde sagt, na ja, vielleicht sollten Sie mal zum Psychologen gehen. Was löst das in dir aus?
Aber das ist ja eben die Chance zu sagen, nee, jeder wird selbstverständlich ernst genommen, aber eben von verschiedenen Seiten aus. Und alles, was ich auch dir erzähle, ist ja immer im Zusammenhang mit meinen imaginären Kollegen, die neben mir sind.
Also ohne Orthopädie, ohne Physiotherapie und ohne Sportwissenschaft könnte ich nicht nicht so gut sein, weil mir der Background fehlt. Genauso brauchen die drei anderen quasi mich im Boot, weil wir eben alle unsere fachlichen Grenzen haben und an der Stelle die anderen brauchen.
[Nils Behrens] (9:26 - 9:42)
Ich finde, Background, das Wort nehme ich jetzt mal ganz kurz auf, weil viele Menschen, du sagst es, sind immer noch sehr kritisch, bei diesem ganzen Thema alles, was so vom Kopf herkommt, so deswegen hilft uns doch mal ein bisschen. Es gibt doch bestimmt auch eine wissenschaftliche Erklärung dafür, wie Rückenschmerzen auch im Kopf entstehen können.
[Catrin Marnitz] (9:43 - 10:32)
Naja, streng genommen entsteht ja alles im Kopf. Also in Extremsituationen, wenn schwere Unfälle zum Beispiel passiert sind und Menschen schwerst verletzt sind, auch sichtbar schwerst verletzt sind, kommt es ja vor, dass sie aber gefühlt und nach außen hin völlig schmerzfrei sind. Das ist der sogenannte Adrenalinschock.
Das heißt, in Extremsituationen entscheidet der Kopf, ob wir Schmerzen erleben oder nicht. Und so funktioniert die Natur. Das heißt, alle Signale, alle Reize, die aus der Peripherie, also dem Körper wahrgenommen werden, werden erst auf kortikaler Ebene, also im Gehirn sozusagen, dechiffriert, bewertet, eingeschätzt, abgeglichen mit anderen Erfahrungen.
Das heißt, ohne Kopf hätten wir ehrlich gesagt auch keinen Schmerz. Wir reden immer über Abspeicherungsprozesse und über die Rückkopplung vom Gehirn, was im Körper eigentlich los ist.
[Nils Behrens] (10:32 - 11:30)
Ja, ich glaube, das kennt jeder. Das ist ja immer so, wenn man irgendwo auch mal beobachtet, wie jemand stürzt oder selbst eben halt man irgendwie einen Sturz hat, das heißt mit dem Fahrrad oder beim Joggen oder auch vielleicht einfach nur beim zu Fuß gehen, dann sind ja mal ganz viele fürsorgliche Menschen im Idealfall um einen herum, also Wildfremde, die dann sagen, oh, alles okay und keine Ahnung was. Und das ist ja irgendwie dann so eine doppelte Situation.
Einerseits ist man völlig überrascht über diesen Sturz, weil der kommt ja meistens nicht mit irgendeiner Vorher-Ankündigung und auf der anderen Seite ist es irgendwie ein total unangenehmes Gefühl, weil man so eine hohe Aufmerksamkeit genießt. Und genau in diesem Moment ist ja die erste Antwort, nee, nee, alles gut, alles gut. Und ich glaube, jeder kennt das.
Das dann, wenn man dann irgendwie so die die fürsorgliche Masse dann weitergezogen ist, auf einmal merkt man so, oh, da tut doch jetzt auf einmal ganz schön was weh. Und ja, also von daher, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass das Gehirn eigentlich erst mal gerade in so einer Situation dann erst mal eine Art abriegelt, sage ich mal sowas. Und dann eigentlich erst so dieses Bewusstsein dann irgendwie eintritt.
[Catrin Marnitz] (11:30 - 11:36)
Genau. Also das Schmerzerleben ist teils wirklich entkoppelt von dem, was an Verletzungen da ist.
[Nils Behrens] (11:36 - 11:44)
Okay, dann lass uns doch mal auf das Thema eingehen, was ja eine große Rolle in deinem Buch spielt. Welche Rolle spielt denn Stress bei dem Thema Rückenschmerzen?
[Catrin Marnitz] (11:45 - 12:47)
Ja, wenn ich mit meinen Patienten und Patientinnen rede, natürlich kennen wir auch selbst: eine riesige Rolle. Also welchen Einfluss hat Stress auf Stimmung und Lebensqualität? Genauso hat Stress negativen Einfluss.
Also was passiert bei Stress? Wir schütten Stresshormone aus, die uns im ersten Moment ja auch schützen sollen. Also ohne Cortisol zum Beispiel wären wir nicht leistungsfähig.
Die Frage ist ja immer, was passiert über die Zeit? Das heißt, die Stresshormone wirken sich irgendwann schmerzverstärkend aus. Wir haben, wenn wir gestresst sind, entsprechend auch stressinduzierende Gedanken.
Schaffe ich nicht. Wird mir alles zu viel. Wie soll ich das bloß alles hinkriegen?
Und auch diese Gedanken wiederum lösen entsprechend Emotionen aus. Also die Emotionen fallen ja nicht vom Himmel, sondern sind ja Ergebnisse, die ja im Kleinhirn produziert werden. Das heißt, es entstehen Emotionen wie Druck, Hilflosigkeit, Ängste, Ohnmacht und die wiederum zeigen sich deutlich in der Muskulatur, wie du es ja am Anfang gesagt hast.
Wenn wir Stressgedanken haben, ziehen wir sofort die Schultern hoch. Das heißt, Stress spielt sich auf allen Ebenen ab.
[Nils Behrens] (12:48 - 12:54)
Ja, und ich glaube, auch das kennen viele Leute, dass man manchmal sich in so eine Negativschleife auch so richtig reinsteigern kann.
[Catrin Marnitz] (12:55 - 12:57)
Klar, wir eskalieren gerne in Stress. Das ist es ja.
[Nils Behrens] (12:58 - 13:16)
Also ich finde auch so diese Unwahrscheinlichkeiten, die ja auch manchmal so sind. Wenn ich dir jetzt sagen würde, so du, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 0,01 Prozent, dass jetzt vielleicht uns diese Lampen gleich auf den Kopf fallen. Dann guckst du erst mal nach oben und denkst so, oh, kann das wirklich passieren?
[Catrin Marnitz] (13:17 - 13:51)
Das sage ich meinen Leuten in den in den Tagesklinikgruppen auch immer, dass ich sage, je mehr Angst wir haben, je unsicherer wir sind, desto verzerrter ist ja die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also wenn die Leute zu uns kommen, dann sage ich immer, die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen auf dem Weg ins Rückenzentrum nichts passiert, ist nicht bei Null. So trotzdem denkt da ehrlich gesagt niemand wirklich darüber nach.
Wenn man aber jetzt erhöhte Ängste hat in U-Bahnen oder im Straßenverkehr oder wenn auch mal was Schlimmes passiert ist im Straßenverkehr, dann hat man unter Umständen eine so verzerrte Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass man gar nicht mehr das Haus verlässt.
[Nils Behrens] (13:51 - 14:03)
Und es ist wirklich bei diesem Thema Sorgen, da gibt es verschiedene Studien auch zu, dass 85 Prozent der Sorgen, die man sich macht, nicht eintreten und die restlichen 15 Prozent sind immer nur halb so schlimm wie das, was man erwartet hat.
[Catrin Marnitz] (14:03 - 14:04)
Aber die schillern umso heller.
[Nils Behrens] (14:04 - 14:17)
Genau. Ja, ich sage ja immer, Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viel. Und von daher arbeitest du ja mit dem Modell des Protektometers.
Magst du vielleicht für unsere HörerInnen mal kurz erklären, wie der funktioniert?
[Catrin Marnitz] (14:18 - 17:18)
Also dieser Protektometer ist ein Handwerkszeug und basiert ja auf dem Behandlungsansatz Explain Pain, Schmerz verstehen. Also die Vermittlung neurobiologischer Grundlagen, das Grundwissen über Schmerz. Das fing vor vielen Jahren an, dass Menschen gesagt haben, wenn wir nicht diese neurobiologischen Fakten in die Therapie einbringen, dann können Menschen auch nicht verstehen, warum sie trotz Schmerz mit krummem Rücken volle Wasserkästen heben sollen.
Das heißt, dieses Grundlagenwissen wird vermittelt und daraus entstanden ist eben ein Tool, dass man sagt, wenn wir doch wissen, dass das Schmerzerleben nicht das Ausmaß der Verletzung widerspiegelt, sondern die Intensität dieser Schutzreaktion. Und wenn wir doch wissen, dass Gedanken und Gefühle, also Kontextfaktoren, einen massiven Einfluss haben, dann lasst uns doch diese Kontextfaktoren mal analysieren. Und dieser Protektometer ist quasi ein Indikator dafür, ob das Gehirn mehr Faktoren gerade hat, die für Gefahr sprechen.
Danger in me. Oder mehr Faktoren hat, die das Alarmsystem wieder runterregulieren. Also Safety in me, SIMs und DIMs, wie wir sagen. Und man kann sich das vorstellen wie so ein Fieberthermometer, dass man sagt, okay, guckt doch mal, welche Stressfaktoren, welche Risikofaktoren sind bei dir gerade da im Verhältnis zu, welche Faktoren laufen ganz gut und schätz doch jetzt mal ein, wo du dich auf dieser Skala gerade befindest.
Und Ziel ist eigentlich mal über den Tellerrand der Sehnen und Muskeln und Nerven hinauszuschauen und zu gucken, okay, warum hatte ich heute einen schlechten Tag? Gar nicht, weil ich mich falsch, sogenannt falsch bewegt habe, sondern weil ich vielleicht Streit hatte oder weil ich unsicher war. Und je detaillierter wir ein Gefühl dafür bekommen, was uns eigentlich alles beeinträchtigt, auch körperlich, desto mehr haben wir Handlungsspielraum und können sagen, okay, man kann jetzt nicht jegliche Stressfaktoren im Leben beseitigen, aber man kann was entgegensetzen.
Man kann Dinge besser ausgleichen. Man kann differenzierter schauen, was hat für mich denn mein körperliches Befinden alles bestimmt? Und das ist eine sehr konkrete Sache, die die Patienten und Patientinnen immer wieder faszinierend finden.
Wenn ich diese Danger und Safety in me, also SIMs und DIMs, sammle, dann sind die am Anfang immer erst mal ratlos und dann helfe ich auch und sage, Mensch, so denkt man über den Schmerz eigentlich nicht nach. Aber lassen Sie uns doch mal eine Stunde Zeit geben, mal alle möglichen Kontextfaktoren durchzugehen. Was denkst du?
Was sagst du? Ist ja nicht immer das Gleiche. Welche Orte?
Welche Menschen? Was alles in deinem Leben hat einen DIM oder einen SIM-Charakter? Und am Ende der Stunde ist die Tafel voll und es ist faszinierend, dass viele hinterher sagen, Mensch, so habe ich noch gar nicht über meinen Schmerz nachgedacht, aber ja, stimmt.
Und dieser Moment, ja, stimmt. Das ist immer so ein kleiner magischer Moment, weil dann wird es plausibel. Ja, stimmt.
Stimmt, was Sie sagen. Das ist toll.
[Nils Behrens] (17:19 - 18:31)
Ja, und es räumt ja auch auf, muss man so sagen. Ich hatte das mal mit einer sehr guten Freundin von mir, die hatte auch so ein Burnout und war dann ein paar Wochen danach hatte sie wieder so, dass sie das Gefühl hat, sie struggelt so ein bisschen. Und dann bin ich mit ihr einmal um die Alster gegangen.
Das ist dann von uns aus einmal rumlaufen und wieder zurück. Ungefähr eine Stunde 15. Und dann habe ich mit ihr einfach mal so besprochen, was denn im Augenblick so ihr größtes Thema ist, was sie so beschäftigt.
Und dann sind wir das wirklich so bis nach unten durchgegangen und geguckt, was eine Lösung dafür sein könnte. Und dann war immer wieder, weil wir haben das Was-Noch-Spiel gemacht, haben wir immer wieder gesagt, okay, und was noch? Dann kam das zweitgrößte Thema.
Und dann wieder so, was noch? Und dann irgendwann merkte man, dass dann mit der fünften Was-Noch-Frage die Probleme immer trivialer wurden. Also wir werden mit Sicherheit nicht bei allen unseren Hörenden jetzt hier so sein, sondern wir werden wahrscheinlich jetzt die einen oder anderen aufschreien und sagen, ich habe mindestens 20 große Probleme.
Aber trotz allem, wenn man mit jedem alles mal wirklich da mit einer anderen Person bespricht und das macht ihr dann ja auch, merkst du dann auf einmal, gerade wenn man es so ausspricht, dass es einen eigentlich viel mehr belastet, als es vielleicht sein müsste, wenn man es mal ausspricht und mal laut reflektiert.
[Catrin Marnitz] (18:32 - 19:42)
Absolut. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht und sagt, okay, jetzt haben wir diese ganzen Faktoren mal gesammelt. Jetzt malen wir doch mal eine Waage auf.
Eine alte Tante-Emma-Waage und hängen jetzt mal diese Gewichte dran. Was sind so Stressgewichte? Was sind so Termine, Familie, irgendwelche Probleme?
Und was sind aber auch die Gewichte, die gut sind, die entspannen, die Ressourcen darstellen? Und sich mal anguckt, okay, ist diese Waage eigentlich noch in Bewegung? Geht die noch übers Lot?
Können wir Dinge ausgleichen und entsprechend auch aushalten? Oder ist die Waage eingerastet auf einer Seite? Können wir uns eben nicht mehr bewegen?
Dann ist das Schöne, dass man sagt, okay, man kann sich jetzt hinstellen und eine Diskussion führen. Ja, alles ist aber schlechter geworden und alles ist mehr geworden, was nicht gut ist. Bedeutet aber auch im Sinne der Waage, was ist denn auf der anderen Seite passiert?
Warum ist die Seite denn so leicht geworden? Und das passiert ja, wenn man Schmerz hat. Was hat man aufgegeben?
Was hat kein Spaß mehr gemacht? Was hat man vernachlässigt? Was hat man aus der Hand gegeben?
Und am Ende stellt man fest, okay, das hängt gar nicht immer nur jetzt eins zu eins mit dem Schmerz zusammen, sondern eigentlich hat die Waage sich schon in eine Richtung oft verändert, bevor der Schmerz da war.
[Nils Behrens] (19:43 - 20:05)
Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, was du da ansprichst. Und ich glaube auch, dass das für mich auch wirklich ein sehr gutes Beispiel für das Thema Psychotherapie ist, weil man genau eben halt diese Dinge einfach mal so ein bisschen, die einen in irgendeiner Weise überfordern, ja irgendwie, sowas so ein bisschen zu strukturieren und damit auch eine Verortung irgendwie zu geben. Welche Warnsignale sollten wir denn ernst nehmen, bevor der Rücken streikt?
[Catrin Marnitz] (20:07 - 21:19)
Also auch da würde ich wieder an die Waage denken. Und ganz, ja, große, aber eigentlich auch simple Fragen stellen. Vielleicht, wann war ich das letzte Mal zufrieden heute?
Oder wann war ich das letzte Mal entspannt? Oder Mensch, wann habe ich mich das letzte Mal auf irgendwas gefreut? Ich erinnere mich, als ich mit meiner Co-Autorin Tina unseren Diagnostik-Tag hatte und sie saß das erste Mal bei mir.
Und Tina war, was Psychologie angeht, sehr skeptisch. Also erfolgreiche Journalistin irgendwie. So, jetzt sitze ich bei einer Psychologin.
Was soll das denn? Und dann stellte ich ihr eben auch diese Frage, wann, wir haben uns damals noch gesiezt, wann waren Sie das letzte Mal eigentlich wirklich zufrieden und entspannt? Und dann schreibt sie ja selbst, dann fing ich auf einmal an zu weinen.
So, und ich glaube, wenn man diese Fragen sich auch traut zu stellen und sich die Zeit nimmt, merkt man, was ist eigentlich insgesamt los? Und ich glaube, das ist eine Sache, die geht natürlich verschütt, dass wir erst hellhörig werden, wenn der Schmerz da ist und vorher die Dinge irgendwie ignorieren oder auch funktionieren. Und ich glaube, dieses Präventivwerden, also sich immer mal wieder fragen, wie läuft es eigentlich?
Mache ich die Dinge gut oder vernachlässige ich irgendwas? Das ist, glaube ich, ein großer Schutzfaktor.
[Nils Behrens] (21:20 - 21:48)
Ja, und ich glaube, man muss da auch für sich sehen, genau wie du sagst, was gibt einem Energie und was raubt einem Energie? Und viele Leute, die immer so von außen auf mein Leben schauen, denken mir so, meine Güte, wo nimmst du die Energie her, all diese Dinge zu tun? Und dann sage ich immer so, weil mir diese Dinge die Energie geben.
Und während das eben halt, was weiß ich nicht, auf eine Veranstaltung zu gehen für andere Leute auch ein Stressor ist, ist es für mich eben halt, sind genau diese Begegnungen, diese Gespräche etwas, was mir die Energie gibt, um eben halt gut durch den Tag zu kommen.
[Catrin Marnitz] (21:49 - 22:44)
Ja, und viele zum Beispiel trauen sich am Anfang auch gar nicht, was jetzt diese Belastungsfaktoren, also Danger in me DIMs betrifft, zum Beispiel auch über Menschen zu sprechen. Ich gehe da immer voran und sage, wissen Sie was, ich habe zwei Töchter. So, das sind meine größten SIMs.
Das sind meine großen Ressourcen. Trotzdem gibt es Momente, da stressen sie mich ohne Ende. Und wir führen bei diesen Dingen keine moralische Diskussion, sondern es geht darum, was ist kräftezehrend?
Also ein pflegebedürftiger Elternteil, den wir über alles lieben, kann trotzdem auch ein Belastungsfaktor sein, weil es einfach mental und körperlich kräftezehrend ist. Und das ist immer dabei wichtig zu betonen, dass es ja immer zwei Seiten einer Medaille gibt, aber niemals moralisch etikettiert, sondern was zieht einfach Energie ab? Was bringt uns einfach an die Überforderung?
Und das kann alles Mögliche sein, genauso wie es aber auch große Ressourcen sein können. Aber was ist im Moment für die Waage relevant?
[Nils Behrens] (22:44 - 23:00)
Es gibt ja diesen Satz, man ist immer so glücklich wie sein unglücklichstes Kind. Und von daher heißt es ja nicht, dass nur weil das Kind unglücklich ist und man damit selbst co-unglücklich wird, dass man deswegen sein Kind weniger liebt. Aber nichtsdestotrotz ist es eben einer der Faktoren.
[Catrin Marnitz] (23:00 - 23:07)
Aber es hilft immer wieder zu sagen, weil es entlastet, weil dann kann man offener sprechen, wenn man das einmal quasi geklärt hat.
[Nils Behrens] (23:07 - 23:19)
Ja, finde ich sehr gut. Wie können wir denn lernen, zwischen, ich sage jetzt mal, dieser Gefahr im Kopf und einer tatsächlichen Verletzung zu unterscheiden? Also tatsächliche Verletzung meine ich keine psychische, sondern eine wirklich physische Verletzung.
[Catrin Marnitz] (23:19 - 23:56)
Ja, also physische Verletzungen sind ja da. Das heißt, da reden wir über einen Akutschmerz. So das heißt, da macht das ja wie gesagt Sinn, dass der Kopf auf Alarm schaltet.
Entscheidend ist ja, was passiert eigentlich, wenn Alarm im Kopf ist, aber die physische Verletzung im engeren Sinne gar keine Rolle mehr spielt. Ja, wenn dir ein Orthopäde sagt, wissen Sie was? Ja, man sieht auf dem Bild einen Bandscheibenvorfall, aber der spielt jetzt klinisch überhaupt keine Rolle mehr, was die Symptomatik betrifft.
Ja, trotzdem haben Sie Angst, sich zu bewegen. So das ist ja das Entscheidende. Deswegen ist es wichtig, an der Stelle natürlich zwischen akuten Schmerzen und andauernden Schmerzen erst mal zu unterscheiden.
[Nils Behrens] (23:56 - 24:29)
Ja, das ist ganz interessant. Ich fand das gerade in einem anderen Podcast-Gespräch auch, wo wir über das Thema Rücken gesprochen haben, dass genau dieser Punkt, also das Thema, wenn die Leute wissen, dass sie Probleme mit der Bandscheibe regelmäßig haben, dass dann häufig Schmerzen entstehen, die genau über die Muskeln oder Faszien entstehen, die wiederum dann auch von Verspannungen ausgelöst werden. Und ich fand das ganz interessant, der entscheidende Punkt, den er sagte, alles, was man durch irgendeine Art von äußerem Druck an Schmerz reproduzieren kann, kann kein Bandscheibenvorfall sein, weil den könnte man von außen nicht triggern.
[Catrin Marnitz] (24:29 - 25:04)
Ja, das Wording ist ja wichtig. Wir unterscheiden ja auch bei uns im Rückenzentrum immer zwischen der Struktur und der Funktion. Also Struktur ist Knochen, so, Bandscheibe.
Das ist wenig beeinflussbar. Aber die meisten leiden ja unter einer dysfunktionalen Funktion. Also das, was uns in Bewegung bringt.
Wenn man Schmerzpatienten und -patientinnen fragt, ja Mensch, was hilft euch denn im Alltag gegen Schmerzen? Dann kommt ja ganz oft Wärme. Ja, Wärme hat auf die Bandscheibe null Einfluss.
Aber eben auf die Funktion, auf die Muskulatur. Und das ist manchmal auch so ein kleiner Aha-Effekt, das auch wirklich zu trennen.
[Nils Behrens] (25:06 - 25:23)
Du schreibst diesen Satz Nicht alles, was wir denken, ist wahr. Das erinnert mich so ein bisschen an das Buch von Kurt Krömer. Du sollst nicht alles glauben, was du denkst.
Das ist immer noch ein großartiger Buchtitel. Welche sind denn die typischen Glaubenssätze, die den Rückenschmerz verstärken können?
[Catrin Marnitz] (25:24 - 26:13)
Alle Glaubenssätze, die Angst und Unsicherheit erzeugen. Also, ich darf mich mit Rückenschmerzen nicht bewegen. Ich darf mich nicht belasten.
Ich darf erst wieder Sport machen, wenn ich schmerzfrei bin. Auch solche Sätze wie: Meine Arbeit macht meinen Rücken kaputt. Oder was ich auch fatal finde.
Ich habe Streit, ich habe psychische Probleme und deswegen bin ich irgendwie schuld, dass ich Schmerz habe. Also alle Gedanken, die in diese Richtung gehen. Oder auch das Katastrophisieren.
Also sich Dinge gedanklich ausmalen. Die schlechteste Version gedanklich anzunehmen, bei der man aber noch gar nicht ist. Und dazu neigen wir und manche besonders, dass wir gar nicht mehr im Hier und Jetzt objektiv gucken, was Sache ist, sondern vielmehr in der Katastrophe leben.
[Nils Behrens] (26:15 - 26:28)
Wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, über sehr negative Glaubenssätze und negative Emotionen und so weiter. Wo würdest du sagen, wie kann man hilfreiches Denken denn trainieren, ohne in so ein Positiv-Blabla zu verfallen?
[Catrin Marnitz] (26:29 - 27:50)
Also mit positivem Blabla hat man im Schmerzbereich keine Chance. Und das ist der Sache auch überhaupt nicht angemessen. Hilfreiches Denken definiert sich ja dadurch, dass wir handlungsfähig werden und dass wir diesen Klickmoment haben.
Also ja, stimmt. Das heißt, kennst du wahrscheinlich auch, wir können nur Dinge gedanklich, aber auch auf der Verhaltensebene ändern, wenn uns die Dinge auch plausibel erscheinen. Wenn wir sagen, ja, da gehe ich mit, kann ich verstehen.
Naja, stimmt, wenn du es so sagst, hast du recht. Das heißt, man kann trainieren, erst mal oft in die Objektivität zu kommen. Und das bedeutet ja nicht, alles ist gut.
Das bedeutet auch nicht, mach eine Fantasiereise und du bist schmerzfrei. Aber eben erst mal zu erkennen, Mensch, ich katastrophisiere oder Mensch, ich sehe Dinge nur einseitig. Ich verliere eigentlich die andere Sichtweise oder habe sie verloren.
Und wenn man dann lernt, wie so ein Anwalt oder wie eine Anwältin zu denken, so was können Anwälte super gut. Die können einem emotionslos Fakten auf den Tisch legen und können sagen, Plan A, Plan B, so sieht es jetzt aus. Und genau das hilft ja, durch diese Objektivität wieder einen Handlungsimpuls zu bekommen.
Dafür muss man aber auch wissen, was man tun kann. Kann ich bestimmte Übungen machen? Habe ich Behandler, die mich gut behandelt haben?
Habe ich eine Idee, was ich alles machen kann? Also hilfreiches Denken macht selbstwirksam.
[Nils Behrens] (27:51 - 28:54)
Ja, finde ich sehr gut. Und ich finde vor allem das, was du sagst, erst mal muss es Sinn machen. Für einen.
Aber dann, finde ich, ist der zweite Punkt, dass es auch anwendbar ist. Erst dann kommt man in die Umsetzung. Weil ich habe das schon ganz häufig immer wieder, wenn die Leute dann immer damit konfrontiert werden, dass sie sagen, ja, sie müssen ihren Stress reduzieren.
Dann ist das ja etwas, wo man sagt, hey, ganz ehrlich, das sucht man sich ja nicht zwingend aus. Und diesen Stress reduzieren, was heißt denn das? Wie du hast gesagt, der Stress durch einen Pflegefall in der Familie, der Stress durch die Arbeit, der Stress durch die Kinder, die vielleicht im Pubertätsalter sind und Liebeskummer haben.
Das sind ja alles Dinge, da sagt man so, ja, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt meine Kinder ins Heim geben und den Pflegefall auch und meinen Job kündigen? Also ich finde, der Punkt, diese Aussage, sie sollten ihren Stress reduzieren, macht für viele Leute erst mal noch mehr Stress.
Und dass man da dann aber tatsächlich in diese Anwendbarkeit kommt, zu gucken, wie, also A, macht es Sinn sozusagen, aber B, auch wie ist der Weg dahin? Ich glaube, dass das da einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
[Catrin Marnitz] (28:54 - 29:26)
Ja, und dass man auf die Symptomebene geht. Ja, also Stress ist ja erst mal ein sehr diffuser Begriff. Und wie du sagst, man kann ja irgendwelche Menschen nicht abschaffen.
Aber wenn man jetzt eine Etage tiefer geht und sagt, okay, ich spüre den Stress, weil ich viele muskuläre Verspannungen habe. Ich spüre den Stress, weil ich abends im Bett liege und gar nicht zur Ruhe komme. Ich spüre den Stress, weil ich Dinge nicht mehr im Alltag mache, die mir Spaß machen.
Daran kann man ja ansetzen. Also typische Catrin-Frage in der Therapie. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt drei Wochen lang es geschafft, den Stress oder die Stresssymptome zu reduzieren und Sie wachen morgen früh auf.
Woran würden Sie es als erstes merken?
[Nils Behrens] (29:29 - 29:40)
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Keine Frage.
Du nutzt ja die kognitive Verhaltenstherapie. Kann man ein einfaches ABC-Modell direkt sozusagen in den Alltag umwenden?
[Catrin Marnitz] (29:41 - 31:24)
Ja, kann man. Also das Modell besagt ja, dass wir Menschen auf bestimmte Situationen oder Auslöser immer mit zwei Konsequenzen reagieren, nämlich mit einem Gefühl und einem Verhalten. Das Entscheidende dazwischen sind aber die B's, die Beliefs, also unsere Bewertung.
Das heißt, wenn ich jetzt morgens aufwache und ich habe Rückenschmerz, dann ist ja die erste Reaktion, dass man sich schlecht fühlt und dass man am liebsten liegen bleiben möchte oder dass man Angst vor dem Tag hat. Der entscheidende Punkt ist ja erst mal zu gucken. Okay, aber was geht dir denn typischerweise durch den Kopf?
Was sind denn die Gedanken, die überhaupt zu diesem C wirklich führen? Ich schaffe das nicht. Ich bin damit allein.
Wie soll ich das bis heute Abend überstehen, so. Und dann kommt nach dem C das D, also die sogenannte Disputationsphase. Bedeutet, in der Stelle geht es darum, diese hilfreichen Gedanken zu entwickeln, wie ein Anwalt zu denken.
Okay, kannst du bestimmte Übungen machen? Was spricht eigentlich dafür? Was spricht dagegen, dass du den ganzen Tag nicht schaffst?
Wie oft dürfte ich dich abends fragen: Na ja, du hast es ja anscheinend doch geschafft. Wie hat es denn funktioniert?
Was hast du denn auch ganz gut gemacht? Also dieses Okay, stimmt, so könnte ich das auch machen. Oder sich nach einer Stunde neu die Frage zu stellen, ist der Schmerz immer noch gleich oder hat er sich vielleicht nach ein, zwei Stunden auch verändert im Laufe des Tages?
Und nach dem D, geht weiter im Alphabet, kommt das E. Also welchen Effekt haben die Gedanken? Man kommt um das Verhalten nicht drum herum.
Man muss halt dann die Übung machen. Man muss vielleicht erst mal aufstehen, heiß duschen. Und vielleicht sollte man sich auch hinsetzen und sich überlegen, okay, Blick in den Kalender, ist der Tag eigentlich jetzt schon zu voll oder geht es darum, auch mal Pausen einzuplanen?
Und dann hinterher zu merken, okay, wenn ich das umsetze, dann helfen die Gedanken mir auch morgens vielleicht mit einem anderen Gefühl irgendwann noch aufzustehen.
[Nils Behrens] (31:26 - 31:56)
Ich bin genau mit diesen Gedanken heute Morgen aufgewacht, dass ich dachte, Gott, wie sollst du diesen ganzen Tag bei mir so voll eigentlich schaffen? Aber ich merke halt einfach in dem Augenblick, wo ich mit dir hier sitze, dass es mir dann irgendwie Spaß macht. Insofern hoffe ich, dass ich damit dann auch die Energie für den restlichen Tag dann mitbekomme.
Insofern, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wovon du gerade redest. Und du sagtest jetzt gerade dieses Thema auch. Das eine ist ja das Thema Mindset.
Aber wir brauchen wahrscheinlich also einfach nur meditieren und reflektieren wird wahrscheinlich nicht reichen, sondern wir brauchen wahrscheinlich auch immer Bewegung, oder?
[Catrin Marnitz] (31:57 - 33:07)
Ja, das klingt immer so abgedroschen, aber Sport und Bewegung ist schon was Magisches, ob jetzt Schmerztherapie oder Depressionstherapie. Und mit Bewegung meine ich jetzt auch gar nicht Sport und muskuläre Kräftigung, was extrem wichtig ist, sondern Alltagsbewegung. Also Treppe statt Fahrstuhl, Kasten Wasser heben, buchstäblich wieder normal in Bewegung kommen und ehrlich gesagt auch trotz Schmerz.
Und Teil der Wahrheit ist auch, es ist auch nicht für jeden Meditation und Yoga jetzt was. Also ich gehe da immer voran. Ich habe beides ausprobiert.
Für mich ist beides ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ist nicht mein Weg. Und ich sage immer, für mich ist die schönste Meditationsübung, wenn ich Rasenmähe oder das Auto poliere.
Also das ist irgendwas zu tun, was uns gedanklich zerstreut. Und dann eben zu gucken auch, an welcher Bewegung habe ich auch Spaß? Natürlich haben Menschen, die gerne Sport machen, und das macht ehrlich gesagt ja auch nicht jede oder jeder.
Natürlich haben die Menschen es leichter, wenn sie es gerne machen. Die anderen müssen erst mal über den Verstand gehen und spüren, dass es auch wirklich hilft. Aber ohne Sport und Bewegung gibt es, glaube ich, auch keinen Weg aus dem Schmerz raus.
[Nils Behrens] (33:08 - 34:49)
Ja, ich kann dir ganz ehrlich sagen, also das Thema Meditation. Ich habe früher immer gesagt, meine Meditation ist das Laufen. Jetzt ist es aber so, dass ich dummerweise aus verschiedenen Gründen gar nicht mehr so viel zum Laufen komme.
Das ist bei mir weniger Motivation, sondern eher ein Zeitproblem. Und deswegen ist natürlich schon, also ich meditiere jetzt nahezu jeden Tag, weil dann eigentlich immer nur so zehn Minuten, weil ich einfach merke, dass diesen Augenblick, mal das Gehirn nahezu im Leerlauf zu haben, für mich gerade so den Tag auch so zu starten, extrem guttut. Und manchmal auch, wenn mich so Sachen sehr stark über den Tag beschäftigen, abends auch so.
Und mein Weg dahin war wirklich über die Atmung sehr stark. Das heißt also, sich nur auf die Atmung zu konzentrieren, hat ja auch schon was Meditatives, weil während einfach nur dasitzen und nichts tun will die meisten Leute, dann denken sie ja doch wieder an zu viele Dinge. So dieser Monkeymind, der dann, wo es geht.
Das Zweite, was du sagst, dieses Thema, die richtige Sportart finden. Ich finde, das ist so etwas der absolut wichtigsten Themen, weil wenn du wirklich sagst, du findest Laufen einfach total, also Joggen gehen, einfach total, sagen wir einfach Suboptimal, um nicht das andere Wort mit s-c-h dann irgendwie zu benutzen, dann muss man einfach was anderes finden. Für andere ist es dann das Thema Radfahren.
Du hast es eben gerade gesagt, Rasenmähen, Rudern. Ich liebe es mittlerweile, zumindest im Sommer hier, ich wohne direkt am Kanal, dann kann ich einfach einmal im Keller gehen, mein Sub aufs Wasser werfen und dann gehe ich eine Runde auf dem Wasser paddeln. So und allein die Tatsache, eine Badehose anzuziehen, ein bisschen Wasser um die Füße zu haben, ist einfach schon wie so ein kleines bisschen Urlaub und so.
Aber so muss jeder sozusagen seinen Weg der Zerstreuung finden. Aber idealerweise sollte er das eben halt A finden und B sollte man sich dabei bewegen.
[Catrin Marnitz] (34:50 - 35:30)
Ja, und es muss Spaß machen. Und wenn man jetzt in die Sportwissenschaft guckt, klar, so was ist für die Stabilisation sehr gut. Es ist natürlich das Krafttraining.
Das heißt, viele, die zum Beispiel sagen, ich finde Krafttraining blöd oder ich mag mich nicht an Geräte setzen, sagen teilweise bei uns nach drei, vier Wochen, ach so schlecht ist das gar nicht. Und sie erkennen, na ja, ganz ehrlich, das ist aber das, was mir geholfen hat. Und das motiviert mich, dass ich wirklich etwas gefunden habe.
Da konnte ich meine Bewertung ändern, weil es plausibel ist. Und weil ich nach drei, vier Wochen Behandlung merke, ja, mein Rücken fühlt sich auch stabiler an. Also da würde ich jetzt die Hoffnung fürs Krafttraining nicht aufgeben.
Aber ja, lieber irgendwas machen, was Spaß macht, als nichts machen.
[Nils Behrens] (35:31 - 36:06)
Und da kommen wir dann aber auch wieder zum Thema Belohnungssysteme. Das ist ja auch eines deiner großen Themen. Also ich muss dir sagen, ich war jetzt schon ein paar Mal bei Legree.
Das ist so eine Art von Reformer Pilates Training, aber eben halt so ein bisschen wie Reformer Pilates on Steroids. Und da kann ich jetzt nicht sagen, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, weil man ist so 50 Minuten lang permanent unter Anspannung. Also ohne irgendeine Pause.
Man wechselt, aber es bleibt die ganze Zeit immer weiter in Spannung. Aber wenn man sich am nächsten Morgen dann im Spiegel sieht, so wenn man aus der Dusche kommt, dann denkt man, ach, also das hat sich gelohnt.
[Catrin Marnitz] (36:07 - 36:08)
Das ist immer ein guter Start in den Tag.
[Nils Behrens] (36:08 - 36:15)
Das ist immer ein guter Start in den Tag. Und von daher, manchmal kommt die Belohnung auch nicht beim Sport, sondern dahinter.
[Catrin Marnitz] (36:15 - 37:00)
Ja, und manchmal werde ich auch streitbar, wenn natürlich auch so Diskussionen kommen. Ja, und mein innerer Schweinehund und ich weiß nicht. Und viele hören natürlich auch wieder auf, wenn es einem klassischerweise gut geht.
Dann kann ich immer aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich bin jetzt 50. Ich habe auch zwei Bandscheibenvorfälle hinter mir.
Ich weiß ja als Psychotherapeutin auch, worüber ich rede, weil ich ja selbst ein Mensch mit einem Rücken bin. Und ich kann mir die Frage, habe ich Bock auf Sport, abgesehen davon, dass ich ihn auch gerne mache, schlicht auch nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten, dass ich sage, mir geht es gut, ich höre auf.
Ich kann es mir nicht leisten, mir etwas für 10 Euro zu kaufen, wenn ich nur fünf auf dem Konto habe. Das heißt, ich überziehe mein gesundheitliches Konto. So und da holt mich auch keiner wieder allein raus.
Und das finde ich, da bin ich ganz einfach gestrickt. Die Tatsache, dass ich mir diese Frage gar nicht leisten kann, die hilft mir.
[Nils Behrens] (37:01 - 37:14)
Finde ich eine sehr interessante Einstellung. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal darüber reden, wir hatten ja gerade schon gesagt, einige Leute wollen einfach keinen Sport machen. Gibt es denn kleine alltagstaugliche, ich sage es einfach mal, Rituale, die sofort spürbar entlassen können?
[Catrin Marnitz] (37:15 - 37:16)
Jetzt in Bezug auf Bewegung?
[Nils Behrens] (37:17 - 37:17)
Ja.
[Catrin Marnitz] (37:22 - 37:38)
Naja, indem man sich zum Beispiel überlegt, gibt es vielleicht doch kleine Übungen, die ich machen kann? Muss ja nicht gleich in Sport ausarten. Kann ich erst mal eine Runde durch den Garten gehen?
Dusche ich morgens erst mal warm? Und also kann ich irgendwas körperlich tun, was es mir erst mal hilft, leichter in den Tag zu kommen? Ja, klar.
[Nils Behrens] (37:39 - 37:59)
Ja, und ich finde, ich erzähle ja in meinen Vorträgen immer, ich mache einen Push-Up, wie heißt das, einen Liegestütz, einen Liegestütz jeden Morgen. Und diese eine Liegestütze, die rettet ja auch nichts. Aber die meisten Leute, wenn sie dann schon auf dem Boden sind, machen dann irgendwann mehr.
Und irgendwann fängt man an Spaß daran zu finden, mehr zu machen.
[Catrin Marnitz] (37:59 - 38:38)
Ja, ich glaube, es ist immer der berühmte erste Schritt. Also finde was, probiere es aus. Also dieses wirklich, komm in die Aktion.
Und daraus entsteht ja meistens was. Und wir Menschen brauchen ja einfach Rituale. Also Rituale helfen uns, Dinge ja auch zu implementieren.
Und wenn du sagst, du machst es jeden Morgen, dann hast du es ja geschafft. Also ich glaube, ehrlich gesagt, also Beispiel Zähneputzen. Also jetzt mal Hand aufs Herz.
Wer hat schon immer intrinsisch Lust und Motivation, sich morgens und abends die Zähne zu putzen? So, wir machen es aber, weil wir es ritualisiert haben und weil wir mittlerweile wissen, okay, es hat langfristig Folgen, wenn wir es nicht tun. Wenn wir das auf den Rücken und auf das Training und auf Bewegung übertragen könnten, dann hätten wir es fast geschafft.
[Nils Behrens] (38:38 - 38:53)
Ich habe durch einen anderen Podcast-Gast, Dr. Kordea Schott, habe ich jetzt mal wieder angefangen. Ich meine, den Tipp haben auch schon hunderte Mal wahrscheinlich die meisten von unseren Hörern schon gehört. Aber dieses auf einem Bein Zähneputzen und so.
Also das, finde ich, ist tatsächlich more challenging, als ich dachte.
[Catrin Marnitz] (38:54 - 38:55)
Das probiere ich dann morgen mal aus.
[Nils Behrens] (38:55 - 39:08)
Ja, also ich mache dann immer untere Zähne links, obere Zähne rechts auf dem Bein stehen. Und also ich werde langsam besser. Aber am Anfang musste ich doch zwischendurch ab und zu mal das Waschbecken kurz zum Halten nehmen.
[Catrin Marnitz] (39:08 - 39:15)
Ja, aber wie schön. Es ist ja auch eine witzige Idee. Und wir lachen jetzt auch gerade drüber.
Und es ist so was Schönes, Handfestes. Und ich glaube, so was brauchen mir.
[Nils Behrens] (39:15 - 39:37)
Ja, und wir verlieren dadurch, das ist null extra Zeit. Weil also diese zwei bis drei Minuten, die zwei Mal am Tag, die machen wir sowieso. Von daher.
Jetzt kommt ein Satz, über den ich so ein bisschen länger nachgedacht habe. Mal sehen, wie ihr bei uns in Hörerin resoniert.
Wer mehr Selbstwert hat, hat auch weniger Schmerz.
Wie hängt das zusammen?
[Catrin Marnitz] (39:37 - 39:39)
Klingt wahnsinnig plakativ, nicht wahr?
[Nils Behrens] (39:41 - 39:42)
Das ist nicht von mir, das ist von dir.
[Catrin Marnitz] (39:42 - 40:34)
Ich weiß, ich arbeite gerne. Typischer Catrin Satz. Nein, also gemeint ist damit, wenn man mehr Selbstwert hat, steckt da ja eine ganze Menge hinter.
Also wo kommt denn unser Selbstwert her? Durch positive Erfahrungen, durch Menschen, die uns guttun, durch Erfolgserlebnisse, durch Selbstvertrauen. Also das sind ja alles Dinge, die uns psychisch resilient machen.
Und ich glaube, wenn wir diese Art von Selbstvertrauen oder Selbstwirksamkeit haben, dann agieren wir auch anders. Wir bewegen uns mehr. Wir treffen uns mit Menschen.
Wir sind offen für Erfolge und entsprechend vielleicht auch toleranter für Misserfolge. Und das sind ja diese psychischen Faktoren, die natürlich auch aus dieser einseitig negativen Spirale uns ja auch rausholen. Also das ist ja so einfach es klingt.
So viel steckt aber dahinter.
[Nils Behrens] (40:36 - 41:15)
Ich kann den vollkommen nachvollziehen. Ich habe aber zugegebenermaßen wenig Schmerzen. Und wenn ich mal Schmerzen habe, dann lasse ich sie eigentlich fast gar nicht zu.
Verstehst du, was ich meine? Also es ist so ganz häufig, wie jetzt bei diesem Thema Laufen. Ich laufe los, merke es auch nicht immer, aber ich sage mal so einmal im Monat habe ich das dann so, dass ich dann morgens loslaufe und dann merke ich, oh, das rechte Knie.
Und dann denke ich immer so, das geht gleich weg. Also so mit der Einstellung gehe ich da ran und dann geht es auch gleich weg. So und genauso.
Ich habe in meinem Leben, glaube ich, ein- oder zweimal eine Kopfschmerztablette genommen, weil ich auch merke, wenn ich mal Kopfschmerzen bekomme, dann denke ich so, nee, Kopfschmerzen ist nichts für mich. Und konzentriere mich dann null drauf und es geht wieder weg.
[Catrin Marnitz] (41:15 - 41:56)
Genau, aber das heißt ja, dass du eine positive Selbstwirksamkeitserwartung hast. Und als Psychotherapeutin würde ich natürlich mal sozusagen einen Zahn zulegen und sagen, okay, vielleicht kann man aber auch so denken, wenn man eine gute Lebensqualität hat.
Also was ist denn dein Background? Was sind denn deine Ressourcen? Nun sehe ich aber auch Menschen, die vielleicht gerade nicht so einen guten Background haben, privat wie beruflich.
Und die natürlich und dann auch noch durch Schmerz on top auch an Selbstvertrauen verloren haben. Und deswegen ist es ja auch dann in der Schmerzpsychotherapie wichtig zu schauen, okay, wo ist denn der Selbstwert hin? Und wie war er denn auch, bevor überhaupt der Schmerz dazukam?
[Nils Behrens] (41:57 - 42:00)
Was empfiehlst du den Menschen, die das Gefühl haben, dem Schmerz ausgeliefert zu sein?
[Catrin Marnitz] (42:04 - 42:42)
Sich Hilfe zu holen. Also ausgeliefert sein heißt ja ohnmächtig sein. Und ich glaube, wenn man an diesem Punkt ist, dass der Schmerz quasi das Leben beherrscht und übermächtig geworden ist, dann ist ja auch der Handlungsradius nur noch sehr klein.
Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, bei dem ich sagen würde, sucht euch Hilfe, nehmt Kontakt zu Behandlern auf, informiert euch über das Thema Schmerz und dass ihr die Erfahrung macht, eben auch damit nicht allein zu sein. Auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man ist mit Schmerzen, auch mit dem Gefühl, dass der Schmerz das Leben beherrscht, nicht allein.
Es gibt so verdammt viele.
[Nils Behrens] (42:42 - 43:00)
Ja, also statistisch gesehen, glaube ich, zwei Drittel der Deutschen haben regelmäßig Rückenschmerzen, von daher ein gutes Geschäft für das Rückenzentrum am Michel, es kommt auch wieder so eine Empfehlung aus deinem Buch, so Routinen wie Tagebuch schreiben oder Dankbarkeitstraining. Kann das tatsächlich Schmerzen lindern?
[Catrin Marnitz] (43:02 - 43:43)
Ja, weil man schreibt ja das auf, was man gemacht hat. Und man setzt sich ja auch mit Einstellungen auseinander. Und ich glaube, also auch das ist wie immer nicht ein Allheilmittel.
Aber ich glaube, wenn man sich mal hinsetzt und sich mal Gedanken darüber macht, worüber freue ich mich, was habe ich heute eigentlich gemacht? Wie habe ich den Tag gestartet? Vielleicht mit dem Gedanken, oh Gott, wie soll ich den Tag überstehen?
Und man nimmt sich abends mal fünf Minuten Zeit und reflektiert, Mensch, eigentlich habe ich doch total viel geschafft. Dann, glaube ich, ändert das die Sichtweise rückblickend. Und wenn man das regelmäßig macht, dann wird es irgendwann vielleicht auch zu einer Einstellungsänderung.
Also ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein.
[Nils Behrens] (43:43 - 44:12)
Ja, Dankbarkeitstraining. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan. Und ich habe es wirklich, ich habe es von Florian Langenscheidt mal gelernt, der sich ja über 30 Jahre mit dem Thema Glücklichsein dann eben auseinandergesetzt hat.
Und das ist der größte Faktor, muss man einfach wirklich so sagen, für jede Kleinigkeit auch dankbar zu sein. Also dankbar auch, dass wir hier sitzen, Wasser haben und miteinander reden können. Viele von unseren HörerInnen sitzen ja viel in ihrem Job.
Was sind deine drei, sagen wir mal, schnellsten Tipps gegen typische Bürorücken?
[Catrin Marnitz] (44:15 - 44:22)
Komplexe Frage, einfache Antwort, ein Dilemma. Drei Sachen. Okay, Punkt eins, zwischendurch aufstehen.
Punkt zwei.
[Nils Behrens] (44:22 - 44:24)
Zwischendurch heißt so einmal die Stunde, oder?
[Catrin Marnitz] (44:24 - 44:33)
Zum Beispiel. Also einfach mal zwischendurch aufstehen. Punkt zwei, ganz wichtig, zwischendurch mal lachen.
Punkt drei, nach der Bürotätigkeit in Bewegung kommen.
[Nils Behrens] (44:34 - 44:47)
Finde ich ausgezeichnete Tipps. Wenn wir heute nur eine Sache mitnehmen, welchen ersten Schritt soll unsere HörerInnen sofort gehen, um ihrem Rücken und ihrem Kopf etwas Gutes zu tun?
[Catrin Marnitz] (44:52 - 45:26)
Spontan. Der erste Schritt raus aus der Angst. Also der erste Schritt ist ja schon getan, wenn man wirklich diesen Satz im Kopf und im Herzen trägt.
Rücken ist auch Kopfsache. Und dann den ersten Schritt raus. Also brauche ich gute Behandler oder ja, vielleicht beschäftige ich mich mit dem Thema Schmerz.
Vielleicht hilft auch dieses Buch. Man muss ja nicht gleich eine Behandlung haben. Aber zu sagen, ich muss Schmerz erst mal verstehen.
Also alles, was den ersten kleinen Schritt raus aus der Angst bedeutet und aus der Ohnmacht ist, glaube ich, der beste Schritt.
[Nils Behrens] (45:28 - 46:07)
Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und ich bin mir ganz sicher, dass das Buch sehr vielen Leuten helfen wird, weil genau dieser ganzheitliche Blick auf das Thema Schmerzen und insbesondere Rückenschmerzen, weil es eben halt ja mit die häufigste, sage ich mal, physische Schmerzensart ist, die in Deutschland so vorkommt. Dann würde ich sagen, dass man da auch mal das von der Kopfsache zu betrachten auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen kann. Und da haben wir ja gelernt.
In dem Augenblick, wenn es einmal Sinn macht und man sagt: Okay, das macht Sinn oder das jetzt verstehe ich es, dann ist schon mal der erste Schritt der Lösung auch da. Das Buch ist erschienen im Rowohlt Verlag und es heißt Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache. Vielen Dank.
[Catrin Marnitz] (46:07 - 46:08)
Von Herzen gern.