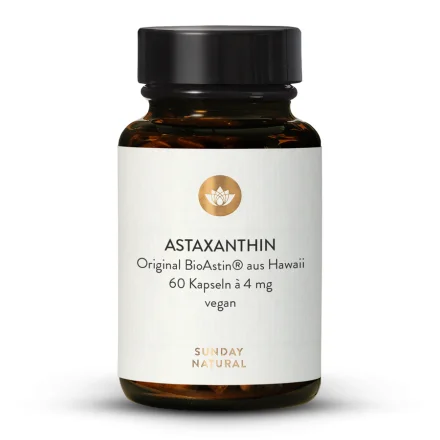Früher erkennen, länger leben: Wie moderne Diagnostik neue Wege der Prävention eröffnet
Dr. Jan K. Hennigs, Internist, Präventionsmediziner und medizinischer Leiter von YEARS, ist überzeugt: Viele chronische Krankheiten lassen sich nicht nur verhindern, sondern sogar Jahre im Voraus erkennen. Doch statt auf Symptome zu warten, braucht es ein Umdenken – hin zu intelligenter Diagnostik, fundierter Analyse und einem Lebensstil, der auf echten Daten basiert.
In der 100. Folge des Healthwise-Podcasts spricht er mit Host Nils Behrens über die wahren Hebel für ein langes, gesundes Leben – und warum klassische Check-ups oft zu kurz greifen.
Warum Prävention neu gedacht werden muss
Herzinfarkt, Diabetes oder Demenz – viele dieser Erkrankungen entstehen nicht plötzlich, sondern entwickeln sich über Jahre schleichend. Laut Dr. Hennigs zeigen Studien: In bis zu 50 % der Fälle ist ein Herzinfarkt das erste spürbare Symptom einer kardiovaskulären Erkrankung.
Das Problem? „Wir diagnostizieren zu spät“, sagt er. „Wenn der Schaden da ist, wird es aufwendig. Dabei könnten viele dieser Krankheitsverläufe frühzeitig gestoppt werden – mit gezielter Diagnostik.“
Fünf Faktoren für mehr gesunde Lebensjahre
Neben den Klassikern wie Ernährung, Bewegung, Schlaf und mentaler Gesundheit identifiziert Dr. Hennigs einen fünften, oft übersehenen Schlüssel: systematische Früherkennung.
Durch moderne Methoden wie genetische Analysen, Multi-Omics, Bildgebung oder neurokognitive Tests lassen sich Risikokonstellationen präzise bestimmen – lange bevor Beschwerden auftreten.
„Früh erkannt, ist halb verhindert. Prävention funktioniert nur, wenn man weiß, wo das Risiko liegt.“
Darmgesundheit: Das unterschätzte Organ
Ein weiteres zentrales Thema: die Rolle des Darms. Der Bauch ist mehr als ein Verdauungsorgan – er ist Kommunikationszentrale für Energie, Stimmung und Immunabwehr. Laut Dr. Hennigs und FX-Mayr-Experte Dr. Henning Sator beginnt echte Gesundheitsvorsorge oft genau hier.
Drei goldene Regeln für einen gesunden Darm:
1. Ballaststoffe als Fundament: Haferkleie, Flohsamenschalen & Co. fördern gesunde Bakterienstämme.
2. Fermentiertes für die Säureflora: Sauerkraut, Kimchi & Co. helfen, Fäulnisbakterien zu verdrängen.
3. Bewegung & Atemtechniken: z. B. die Buteyko-Methode – gut für Vagusnerv und Darmperistaltik.
Genetik und Mikrobiom: Was man wissen will – oder lieber nicht
Genetische Analysen können wertvolle Hinweise liefern – etwa auf Krebs- oder Alzheimerrisiken. Doch wie damit umgehen? Für Dr. Hennigs ist klar: Jeder Mensch hat das Recht auf Wissen – aber auch auf Nicht-Wissen.
Ebenso differenziert bewertet er Mikrobiomanalysen: „Vieles ist hier noch experimentell. Interventionen wie Probiotika helfen nur, solange man sie nimmt – danach fällt das Mikrobiom oft wieder in den Ursprungszustand zurück.“
Mehr erfahren im healthwise Podcast von sunday natural
Mentale Gesundheit- messbar gemacht
Ein stabiler Geist braucht messbare Werte. Dr. Hennigs setzt hier auf eine Kombination aus:
- Herzratenvariabilität (HRV) als Stressindikator
- neurokognitiven Leistungstests
- standardisierten Fragebögen zu Angst, Depression & Wohlbefinden
So wird psychische Resilienz nicht nur spürbar, sondern belegbar – ein echter Fortschritt im Bereich ganzheitlicher Gesundheit.
Der Unterschied: Diagnostik als Wegweiser, nicht als Statusbericht
Viele Check-up-Anbieter liefern dicke Berichte, aber wenig Klarheit. YEARS geht laut Dr. Hennigs einen anderen Weg: Ein strukturierter, verständlicher Plan – sortiert nach Organsystemen, priorisiert nach Handlungsbedarf. Ergänzt durch Lifestyle-Empfehlungen, Supplement-Optionen und, falls nötig, gezielte Medikation.
„Wir wollen ein Frühwarnsystem etablieren – kein Angstsystem.“
Fazit: Moderne Prävention beginnt mit einem ersten Schritt – und der richtigen Frage
Nicht „Was fehlt mir gerade?“, sondern: „Was kann ich tun, um gesund zu bleiben?“
Dieser Perspektivwechsel ist der Kern einer neuen Präventionsmedizin, wie sie Dr. Hennigs und sein Team bei YEARS praktizieren. Kombiniert mit fundiertem Wissen, modernster Technik und einem respektvollen Umgang mit individueller Verantwortung.
Produktempfehlungen von Sunday Natural zur gezielten Unterstützung
Dr. Jan K. Hennigs, Internist, Präventionsmediziner und medizinischer Leiter von YEARS, ist überzeugt: Viele chronische Krankheiten lassen sich nicht nur verhindern, sondern sogar Jahre im Voraus erkennen. Doch statt auf Symptome zu warten, braucht es ein Umdenken – hin zu intelligenter Diagnostik, fundierter Analyse und einem Lebensstil, der auf echten Daten basiert.
100 Der Gesundheitscheck der Zukunft. Mit Dr. Jan K. Hennigs
[Dr. Jan K. Hennings] (0:00 - 0:18)
Aber wenn du die Antioxidantien zum Beispiel ansprichst, da ist es zum Beispiel so, dass wir reaktive Sauerstoffspezies brauchen. Reaktive Sauerstoffspezies sind ganz wichtige Signalmoleküle in den Gefäßwänden. Und wenn wir die mit hochdosierten Antioxidantien raushauen, dann schädigen wir unsere Gefäßwände.
[Nils Behrens] (0:18 - 1:16)
Herzlich willkommen zu HEALTHWISE, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit.
Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Zum hundertsten Mal sammeln wir Erkenntnisse für ein langes, vitales Leben und wollen dabei die gesamte diagnostische Bandbreite beleuchten. Heute zeigen wir, wie du in allen Lebensbereichen proaktiv fitter bleibst.
Dr. Jan K. Hennings ist Internist, Primitivmediziner und medizinischer Leiter von YEARS. Seine Praxis in Berlin setzt auf ein ganzheitliches Diagnose-Konzept von Blut über Urin-Biomarker, über Bildgebung, Genetik und Multi-Omics. Bis hin zu neurokognitiven Tests und mentaler Gesundheit.
Also ganz schön viel. Und deswegen sage ich, herzlich willkommen Dr. Jan K. Hennings. Hallo Nils, freut mich hier zu sein.
Jan, wie gesund war dein letzter Sonntag und woran merkst du das eigentlich?
[Dr. Jan K. Hennings] (1:17 - 1:58)
Der letzte Sonntag war gar nicht so gesund, wenn ich ehrlich bin. Ich war am Superhuman Summit, das Closing, das ging bis in die Nacht. In Stockholm?
In Stockholm, ich glaube, du warst auch dabei. Ja. Und die Nacht war kurz, dann Reisestress, nicht richtig gegessen, sogar mal Alkohol getrunken dazu.
Das merkt man, das schlaucht. Da merkt man auch, dass man nicht mehr 18 ist. Und das merkt man nicht nur subjektiv, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, bisschen höhere Reizbarkeit, sondern das kann man natürlich auch messen.
Höhere Herzschlag, Herzratenvariabilität eingeschränkt. Genau, also das war der letzte Sonntag. Der ist aber nicht so repräsentativ.
[Nils Behrens] (1:58 - 2:16)
Nicht so repräsentativ. Und man muss sagen, für Bryan Johnson war er wahrscheinlich auch nicht so repräsentativ, weil er hat bis drei Uhr morgens dann auch noch getanzt. Also wenn man weiß, dass er normalerweise um halb neun, glaube ich, immer schlafen geht, war das auch nicht so seine Zeit.
Wobei, ich überlege jetzt gerade, dass in US-Zeit gerechnet, war er dann vielleicht gar nicht so sehr aus dem Rhythmus.
[Dr. Jan K. Hennings] (2:16 - 2:18)
Ja, aber er ist ja schon ein paar Tage in Europa gewesen.
[Nils Behrens] (2:18 - 2:43)
Ja, er ist ein paar Tage in Europa und er war ja auch um neun Uhr auf der Bühne. Oder um zehn, wann ging es los? Nee, um zwölf.
Um zwölf ging es los. Ging erst um zwölf los. Das heißt, also das war dann seine Aufstehzeit.
Er steht ja um fünf Uhr morgens auf. Da vielleicht ist er einfach in seiner Zeitzone geblieben. Okay, wir kommen vom Thema ab.
Wir haben die hundertste Folge HEALTHWISE mit wirklich vielen Erkenntnissen. Was würdest du sagen, ist so einer der größten Hebel für ein gesundes Alter?
[Dr. Jan K. Hennings] (2:44 - 3:40)
Also, es gibt mehr als wirklich nur einen Hebel. Es gibt, ich glaube, fünf Hebel. Fünf ist auch so eine spannende Zahl.
Es gibt fünf sehr gut untersuchte Hebel. Ernährung, Sport, Schlaf, mentale Gesundheit. Das sind tatsächlich die größten Hebel, die wir haben.
Es gibt einen unterschätzten Hebel und deswegen sind wir da. Das ist frühzeitige systematische Diagnostik. Das ist ja so, viele dieser altersbedingten Erkrankungen und Volkskrankheiten entwickeln sich ja schleichend über Jahre oder sogar Jahrzehnte, ohne dass sie Symptome machen.
Und ganz, ganz häufig ist es so, dass tatsächlich erst, wenn Organschäden auftreten, Patienten merken, dass sie solche Erkrankungen haben. Typisches Beispiel der Herzinfarkt. 50% der Fälle ist der Herzinfarkt das erste Symptom einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.
[Nils Behrens] (3:41 - 3:43)
Das ist ja schon ein sehr massives Symptom.
[Dr. Jan K. Hennings] (3:44 - 4:13)
Absolut massives Symptom, genau. Und wir wissen mittlerweile durch Arbeiten meiner ehemaligen Kollegin Christina Magnus im UKE, dass wir mindestens 50% dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern könnten durch die Big Five, durch Vermeiden der Big Five. Vermeiden von Typ 2 Diabetes, von Non-HDL-Cholesterolerhöhung, Rauchen, Übergewicht und systolischem Blutdruck, also Bluthochdruck.
[Nils Behrens] (4:14 - 4:14)
Ja.
[Dr. Jan K. Hennings] (4:14 - 4:36)
Genau. Das heißt also, wir müssen frühzeitig diagnostizieren. Und wenn wir es schaffen, frühzeitig zu diagnostizieren, frühe Risikokonstellationen festzustellen, zum Beispiel diese Big Five zu vermeiden, dann schaffen wir es auch, gesunde Lebensjahre zu verlängern.
Und das hat Christina gezeigt in der aktuellen Studie aus diesem Jahr. Mindestens 10 Jahre bei Frauen, sogar bis zu 15 gesunde Lebensjahre mehr.
[Nils Behrens] (4:37 - 4:58)
Bei wem, bei Frauen oder bei Männern? Bei Frauen 15 gesunde Lebensjahre. Ja, das ist ja sowieso interessant.
Wir hatten ja schon mal eine Folge zu dem Thema Herzgesundheit bei Frauen. Das ist ja so ein Thema, man denkt immer so, ich fand das ganz interessant, in dem Interview hat die Ärztin dann auch gesagt, wenn Frauen aufwachen und man ihnen sagt, dass sie einen Herzinfarkt haben, dann sagen sie, wieso, ich bin doch eine Frau. Das stimmt.
[Dr. Jan K. Hennings] (4:59 - 5:17)
Es gibt tatsächlich auch eine systematische Unterversorgung von Frauen im Gesundheitssystem, auch bei Herzgesundheit muss man sagen. Symptome von Frauen sind häufig anders als von Männern beim Herzinfarkt und die werden dann häufig nicht so ernst genommen. Und tatsächlich ist es so, dass Frauen insgesamt schlechter versorgt sind bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
[Nils Behrens] (5:17 - 5:37)
Ich komme auf den Teil gleich nochmal zurück. Ich habe hier meine Fragen und ich bin nicht so flexibel, dass ich jetzt hier alles über den Haufen werfe. Nein, jetzt mal ernsthaft.
Welche Rolle spielen denn genetische und epigenetische Analysen für deine Prävention? Das heißt, ist das ein relevanter Punkt auch in der Prävention?
[Dr. Jan K. Hennings] (5:38 - 7:40)
Ja, absolut. Man muss ein bisschen unterscheiden. Die Genetik, also unsere Hardware, was im Erbgut ist, was wir bisher noch nicht verändern können, muss man sagen.
Wir haben viel daran gearbeitet. Und die Epigenetik ist die Software sozusagen. Also das, was von Umwelteinflüssen beeinflussbar ist, auch durch Medikamente beeinflussbar ist, auch durch vor allen Dingen Lebensstil, Verhalten beeinflussbar ist, also wie welche Gene abgelesen werden können.
Und für die Genetik gibt es klar, in dem Kontext von insbesondere medizinischer Genetik, also durch human Genetiker prädiktive Analysen durchgeführt und präventive Analysen durchgeführt, gibt es eine klare Bedeutung. Es gibt bestimmte Risikogene. Jeder kennt das Brustkrebsrisikogen BRCA1 und 2 oder auch das Tumorunterdrückungsgen TP53.
Wenn da Mutationen sind, dann besteht eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, entweder einen Brustkrebs oder einen Arealkarzinom zu bekommen oder eben bei dem TP53 verschiedenste Krebse im sehr jungen Alter zu bekommen. Das heißt, das sind relevante Informationen aus der Genetik, wo man intervenieren kann. Bei den BRCA-Mutationen geht es dahin bis zum Abtragen, Abnehmen der Brüste bei der Frau, je nachdem, wie das Risiko ist.
Bei dem TP53 z.B. 3-monatige MRT-Untersuchungen, um zu schauen, wo sich Tumoren befinden. Bei der Epigenetik ist es ein bisschen komplexer. Die Epigenetik ist noch ein experimentelles Tool, aber es ist ein sehr spannendes Tool, weil wir aus Tierversuchen wissen, dass wir Epigenetik reprogrammieren können und dann dadurch Zellen und Organismen verjüngen.
Für Menschen gilt das noch nicht. Wir nutzen Epigenetik als experimentelles Tool und nutzen auch z.B. epigenetische Alter, aber auch nur im experimentellen Kontext. Das sind Risikomodelle, um zu zeigen, gibt es erhöhte Risiken für bestimmte altersbedingte Erkrankungen oder für verfrühtes Versterben.
[Nils Behrens] (7:40 - 8:56)
Ich finde das ganz interessant. Ich hatte solche genetischen Tests schon gemacht. Da haben mich vorwiegende Leute darauf angesprochen und gesagt, ich würde das niemals machen.
Was ist, wenn da ein Risiko rauskommt? Da hätte ich immer das Gefühl, dass da eine Art self-fulfilling prophecy rauskommt. Ich hatte das Glück, ich habe wahnsinnig gute Gene, ich habe sehr wenig Risiken, wahnsinnig wenige.
Das hat selbst die Analystin gesagt, dass sie selten solche wenigen Auffälligkeiten hat. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt sage, das einzige Karzinomrisiko, was ich erhöht habe, ist tatsächlich Prostata. Da würde ich sagen, naja, welcher Mann nicht?
Das macht mich noch nicht so richtig nervös. Aber ich will nur sagen, wenn du jetzt wirklich etwas hast, wo du dann sagst, okay, jetzt lebe ich mit diesem erhöhten, du hast es gerade genannt, Brustkrebsrisiko. Wobei dieses eine Gen, was mittlerweile Angelina Jolie-Gen ist, das hat vielleicht noch mal eine Sonderstellung.
Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch andere Marker, wo man sagt, du hast ein erhöhtes Risiko, an dem und dem Krebs zu erkranken. Hast du da Erfahrungen mitgemacht, dass Patienten darauf dann wirklich so reagieren, dass sie dann sagen, oh Gott, ich habe das jetzt?
[Dr. Jan K. Hennings] (8:58 - 10:44)
Das Allerwichtigste dabei ist, dass das eine freiwillige Entscheidung ist, wie du sagst. Jeder hat natürlich auch das Recht zum Nichtwissen. Ich habe mich durchsequenzieren lassen, meine Frau z.B. nicht. Die ist auch Ärztin. Die sagt, ich möchte diese Risiken nicht kennen. Auch Ärztin an der Uni.
D.h., die ist auch eine sehr wissenschaftlich geprägte Frau oder Ärztin, aber sie möchte dieses Risiko nicht haben. Das, finde ich, ist eine absolut faire Sicht auf die Dinge. Bei mir ist das anders.
Ich möchte meine Risiken wissen, denn ich bin davon überzeugt, dass man nur ändern kann, was man auch wirklich weiß. Man kann nur gezielt intervenieren, wenn man wirklich weiß, wo die Risiken liegen. Denken wir an Alzheimer z.B. APOE4 ist ja so ein typischer Genotyp, Homozygot. Bedeutet, dass man mit Mitte 50 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon Frühzeichen von Alzheimer oder zumindest Anzeichen von Alzheimer entwickelt. Zum einen würde ich mir andere Lebensziele setzen, wenn ich das wüsste. Nicht in 20 Jahren, sondern kurzfristiger.
Wenn du in deinem Leben unbedingt mal die Pyramiden sehen möchtest, dann machst du es lieber jetzt. Genau. Ich würde die Zeit mit der Familie, mit den Kindern dann doch noch stärker priorisieren.
Zum anderen kann man aber auch versuchen zu intervenieren, auch bei Alzheimer. Auch wenn es noch keine gezielte Therapie für diesen Genotypen gibt. Kann man natürlich versuchen, durch Lebensstilanpassung, durch Anpassung der Herz-Kreislauf-Risiken, das Risiko zu verhindern.
Man kann versuchen, durch Hirntrainings, natürlich versuchen, Alzheimer etwas weiter rauszuschieben.
[Nils Behrens] (10:45 - 10:59)
Was ich sehr gut verstehen kann, ist, dass bei einem genetischen Risiko die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, die haben wir ja alle in uns. Rein rechnerisch gesehen bekommt jeder zweite Krebs.
[Dr. Jan K. Hennings] (11:02 - 11:06)
70% der 70-jährigen Männer haben Prostatakarzinom, wie Pathologen immer.
[Nils Behrens] (11:07 - 11:44)
Zum Beispiel. Da kann man jetzt einfach sagen, ich möchte das Risiko nicht wissen, weil es letztendlich vielleicht für mich nur etwas ins Negative verändert, weil es eben ein theoretisches Risiko ist. Wenn man jetzt aber mal in die Multicancer-Screenings reingeht, wenn man jetzt zum Beispiel in so etwas wie Liquid Biopsy reingeht, dann kann man ja wirklich sagen, okay, das eine ist eben wirklich so eine Prädisposition, das andere ist ja etwas, wo man wirklich gezielt eine Art von Diagnostik durchführt.
Magst du vielleicht an der Stelle einfach mal sagen, was ist zum Beispiel eine Liquid Biopsy? Klar.
[Dr. Jan K. Hennings] (11:45 - 12:55)
Liquid Biopsy ist vom Prinzip so, dass man Blut oder im Grunde gilt das für jede Körperflüssigkeit, aber häufig ist das Blut entnimmt und schaut im Blut, gibt es dort zirkulierende Tumorzellen, gibt es dort zirkulierende Tumor-DNA oder findet man bestimmte Tumormarker im Blut, die nicht klassisch sind, sondern andere Marker. Diese drei Dinge sind im Grunde Liquid Biopsy. Das ist eine schöne Idee.
Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber im Prinzip, aber diese Multicancer Early Detection Tests sind gar keine Early Detection Tests, sondern das sind Multicancer Detection Tests. Denn diese ganzen Verfahren funktionieren besonders gut bei fortgeschrittenen Tumoren.
Und da beiße ich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Weil es gar nicht so early ist? Weil es gar nicht early ist.
Bei den Early Cancers sind die alle nämlich noch relativ schlecht in der Detektionsrate. Das sind eher Verfahren, die zum Ausschluss von Krebsarten sind. Fortgeschrittenen Krebsarten muss man sogar noch dazu sagen.
Das heißt also, die sogenannte Spezifität ist hoch bei den Testverfahren. Und dann hat man mit 99 oder 99,5% Wahrscheinlichkeit kein Tumor, wenn der Test negativ bleibt, zu dem Zeitpunkt, wo man geschaut hat.
[Nils Behrens] (12:55 - 13:06)
Aber es ist ja im Gegensatz zu dem epigenetischen oder dem genetischen Risiko der genetischen Prädisposition, sag ich mal so, wo ich über eine Theorie rede, gibt mir das zumindest Peace of Mind, muss man ja wirklich auch so sagen.
[Dr. Jan K. Hennings] (13:06 - 13:35)
Ja, aber es gibt halt in der Medizin nirgendwo absolute Wahrheiten. Auch da ist es so, also erst mal 99,5% heißt 0,5% falsch negativ. Und wenn man das skaliert auf Millionen von Menschen, sind das viele, viele Tausend Fälle, die man nicht detektiert hat.
Das ist das große Problem dabei. Also auch da muss man das immer als ein Teil im Gesamtkontext betrachten und nicht als absolute Wahrheit. Okay, habe ich verstanden.
[Nils Behrens] (13:36 - 14:52)
Wenn wir jetzt mal weitergehen, auch zum Thema Krebs-Screening, das ganze Thema Ganzkörper-MRT. Also ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Medizinbranche und da muss man immer sagen, also eigentlich spricht da niemand oder sagt niemand etwas Positives, Sinnvolles darüber, es sei denn, man bietet es selbst an. Und jetzt ist die Frage, also ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen, was sind die zwei von mir bekannten Hauptkritiken.
Das eine ist, es gibt eben so eine Art Scheinsicherheit, weil die Durchsequenzierung natürlich nicht so genau ist. Jeder, der mal ein Organ hat sequenzieren lassen, der weiß, dass das ungefähr eine halbe Stunde dauert. Ein Ganzkörper-MRT, glaube ich, dauert eine Stunde, anderthalb.
Ich weiß gar nicht so genau, irgendwie sowas in dem Dreh. Das heißt, also du kannst natürlich gar nicht so granular runtersequenzieren. Und von daher kann eben halt einige von den Tumorarten, die ja auch nur sehr klein sind, sage ich mal sowas, wenn du dann irgendwie so die Sequenzen dann, was weiß ich nicht, einen Abstand von einem Zentimeter haben, kann schon sein, dass dann eben halt genau dieser Schicht dazwischen dann irgendwie der Tumor ist.
Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch, dass man grundsätzlich in der Medizin natürlich immer mit einer gewissen Hypothese reingeht, wonach man sucht. Dadurch aber im ganzen Körper suchst, ist natürlich die Hypothese auch nicht, sondern nicht präzise so.
Ihr bietet es an. Wie ist dein Blick auf die Dinge?
[Dr. Jan K. Hennings] (14:52 - 16:24)
Also du sprichst extrem wichtige Punkte an. Und wir haben das sehr, sehr viel diskutiert. Bieten wir das überhaupt an?
Bieten wir das nicht an? Mit unserem Beraterkreis an akademischen Radiologen ist es eine relativ klare Sichtweise, dass so ein unstrukturiertes Ganzkörper-MRT sehr, sehr wenig medizinischen Nutzen hat. Es nutzt eher für Patientinnen und Patienten, für Kunden zu schauen, wie sieht es im Inneren des Körpers aus.
Wir haben versucht, das Problem zu lösen, weil wir natürlich A, ein wissenschaftliches Interesse an den Bildern haben, im Rahmen der Konstellation Risiken erkennen und Risikomodelle entwickeln. Und B, weil wir schon mit unserem Beraterteam darauf gekommen sind, dass man sagt, man kann verschiedene klinisch relevante Sequenzen ohne Kontrastmittel, übrigens ein weiteres Problem bei den Ganzkörper-MRTs, sie werden eigentlich immer ohne Kontrastmittel gefahren, aneinanderhängen. Und so kann man ein Pseudo-Ganzkörper-MRT schaffen mit aber klinisch aussagekräftigen Sequenzen für das Gehirn, für die großen Hirngefäße, Time of Flight-Analyse zum Beispiel, für die Leber, Leberverfettung, Abdomen, solche Dinge kann man machen.
Das heißt, wir haben ein Pseudo-Ganzkörper-MRT geschaffen. Und du hast vollkommen recht, wenn wir jedes Organ wirklich, richtig nach klinischem Goldstandard durchdiagnostizieren wollten mit einem MRT, dann liegen die Patienten stundenlang da drin. Das ist in der Enge, in der Wärme, in der Lautstärke eigentlich gar nicht machbar.
[Nils Behrens] (16:24 - 16:27)
Das wird nur noch getoppt durch die Enge und Wärme dieses Podcaststudios.
[Dr. Jan K. Hennings] (16:29 - 17:35)
Genau, und ein ganz wichtiger anderer Punkt, den man auch tatsächlich nicht unterschätzen darf beim Ganzkörper-MRT, sind die Inzidentalome. In einem Viertel bis zu 40% der Fälle entdeckt man Inzidentalome. Das heißt, es sind kleine Auffälligkeiten, die aussehen wie Tumore.
Und wenn man sie dann biopsiert, also wenn man dann ein Risiko behaftet, weitere Diagnostik durchführt, kommt raus, dass sie klinisch nicht relevant sind. Und das ist etwas, was man auch immer im Hinterkopf haben muss, wenn man ein Ganzkörper-MRT macht. Wir koppeln deswegen die Bildgebung immer mit sehr, sehr strukturierter, hochauflösendem Ultraschall, um dieses Risiko zu minimieren, haben Partner, die exzellente Diagnostiker sind, die versuchen, das so gut es geht, auch aus den Radiologiebildern schon runterzufahren, um eben kein Scare, kein Cancer-Scare zu machen.
Den gibt es nämlich natürlich. Und so gehen wir dieses Thema an. Und die Hypothese ist quasi Anatomie, anatomische Einblicke zu gewinnen.
Aber die Kritik, die du hast, die teile ich sogar.
[Nils Behrens] (17:36 - 18:50)
Kommen wir mal zu dem Thema Darmgesundheit. Es ist ja so, dass beim Lanserhof galt immer so, der Darm ist die Wurzel des Menschen oder die Wurzel des Menschen und der Gesundheit sozusagen. Wenn ich jetzt mal in das Thema Mikrobiomanalyse reingehe, dann muss ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass mein Mikrobiom, oder vielleicht minimal ausgeholt, das sind ja verschiedene Bakterienstämme, die da so zusammenkommen.
Und die zwei großen Arten sind die Bakterien und die Firmicuten. So, idealerweise hast du ein ausgeglichenes Verhältnis von diesen beiden großen Stämmen mit einem leichten Überhang der Bakterien. Bei mir ist es so, ich habe 81% Firmicuten.
81% Firmicuten sind in der Regel Leute, die sich nur von Zucker ernähren, kurzkerzigen Kohlenhydrate und in der Regel auch massiv übergewichtig sind. So, das bin ich alles nicht und mache ich auch alles nicht. Jetzt ist es so, dass wenn ich einen Probiotika nehme, dann ist es dann so, dass ich, wenn ich dann wieder teste, dieses perfekte ausgeglichene Mikrobiom habe.
In dem Augenblick, wo ich sie weglasse, ist es wie so ein Gummi, was dann irgendwie wieder in seine alte Position zurückfällt, bin ich wieder bei 81% Firmicuten. So, und jeder Mensch, der sich mit Mikrobiom auskennt und darauf schauen würde, würde sagen, das kann nicht deins sein.
[Dr. Jan K. Hennings] (18:51 - 20:46)
Ja, absolut. Also auch da muss man sagen, du gehst wirklich hier an die Grenzen der klinisch interpretierten Medizin. Auch das ist ein experimentelles Verfahren.
Mikrobiom ist noch ein experimentelles Verfahren in der Medizin. Die Evidenz, dass man sagen kann, wir bauen wirklich Therapien auf dem Mikrobiom, die ist für den Menschen noch nicht da. Das ist immer, glaube ich, was man vorausschicken muss.
Und dann muss man einmal verstehen, wie viele dieser Analysen stattgefunden haben. Das sind Assoziationsstudien. Das hat man halt geschaut.
Man findet dieses Mikrobiom, also diese Zusammensetzung von Mikrobiota, Mikrobiom ist eigentlich nur die Gene der Mikrobiota, und das ist assoziiert mit dieser Krankheit, das ist assoziiert mit diesem Lebensstil, das ist assoziiert mit diesem Ernährungsstil. So bilden sich auch Enterotypen. Und das ist natürlich, normal verteilt, die Gesamtpopulation nicht individuell zu treffen.
Das sind einfach Dinge, die man da im Moment berücksichtigen muss. Es gibt tatsächlich auch sehr wenig Evidenz behaftete Interventionen, von denen wir wissen, dass sie wirklich sinnvoll sind. Zum Beispiel eine C-Diff-Infektion, also eine schwere Darminfektion, die nicht gut behandelbar ist.
Da ist so eine Stuhltransplantation auch sogar empfohlen, als eine Therapie-Eskalationsstufe. Die braune Suppe, wie man es früher... Die braune Suppe, genau.
Die gibt es ja auch mittlerweile als Kapseln. Muss man nicht mehr durch den Nasenschlauch transplantieren. Oder bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen gibt es ganz gute Daten.
Auch bei übergewichtigen Typ-2-Diabetikern. Akkermansia, Probiotika führen dazu, dass die Insulinsensitivität steigt, dass andere metabolische Veränderungen sich verbessern. Aber, auch da ist es genau so, wenn man das absetzt, die kolonisieren nicht, sondern dann kommt das alte Mikrobiom wieder.
Also da sind wir noch nicht so weit.
[Nils Behrens] (20:46 - 21:04)
Dann lass uns doch mal was betrachten, wo ihr wirklich auch soweit seid und wo es auch gewisse Evidenzen gibt. Ihr führt ja zum Beispiel standardmäßig einen Lungenfunktionstest durch, Herz-Kreislauf-Diagnostik, einen 3D-Body-Scan und verschiedene Leistungstests auf Basis von Spiroergometrie. Was ist der große Unterschied zu einer üblichen Sportdiagnose?
[Dr. Jan K. Hennings] (21:04 - 21:52)
Genau. Ich glaube, der größte Unterschied, den du ansprichst ist, oder von den Untersuchungen, die du ansprichst, ist, dass die Sportdiagnostik eher auf Leistungsoptimierung ausgerichtet ist und bei uns geht es durch die Integration aller Befunde und noch mehr, wir gucken ja wirklich von Kopf bis buchstäblich Hacke, nach Risiken, um dann individuelle Krankheitsfrühwarnsysteme, nennen wir das für die Patienten, also Risikoprofile für die Patienten, zu entwickeln, um dann zu schauen, wo sind Risiken, wo man intervenieren kann, früh intervenieren kann.
Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Also das Ziel einer klaren Prävention mit einem klaren Risikoprofil versus Leistungsoptimierung.
[Nils Behrens] (21:52 - 22:29)
Das, was ich ganz interessant fand, als ich den Test gemacht hatte, war auch so eine gewisse, ich sage jetzt mal so, Mobilitätstest, so die Beweglichkeit und allem drum und dran. Mein grundsätzlicher Frag für Alte und Junge, wir wissen ja mittlerweile, dass die Mortalität ab 65 bei einem Sturz sozusagen mit einem Bruch verbunden, ich glaube bei 33 Prozent liegt. Das heißt, 33 Prozent der Leute nach einem Sturz über 65 versterben innerhalb der nächsten zwölf Monate.
Das heißt aber für uns, wie viel macht dann, also inwieweit schaut ihr denn, dass es eben halt auch Gebrechlichkeits-Tests gibt und machen die Sinn?
[Dr. Jan K. Hennings] (22:30 - 22:46)
Genau. Also wir wenden nicht die klassischen Gebrechlichkeits-Tests an, weil die nämlich genau für Leute über 60 entwickelt worden sind. Stattdessen gucken wir uns Beweglichkeit, Mobilität, Schnellkraft an, Balance, solche Marger.
[Nils Behrens] (22:46 - 22:51)
Balance war shocking für mich. Ich dachte eigentlich, ich hatte eine sehr gute, aber in dem Moment, wo man die Augen zumacht, merkt man, not.
[Dr. Jan K. Hennings] (22:51 - 23:46)
Es ist total schwierig. Es ist wirklich schwierig. Das muss man echt trainieren.
Und das sind aber genau wichtige Faktoren. Also das sind biologische Funktionsmarker, die sich dann in Gebrechlichkeit übertragen, wenn die Skelettmuskulatur natürlich entsprechend schwach ausgebildet ist, die Balance nicht hat, Fallneigung dadurch steigt. Das sind alles Dinge, die erhöhen das Verletzungsrisiko.
Das wissen wir auch aus dem Sport tatsächlich. Das machen wir. Das machen wir sehr systematisch.
Wir haben das jetzt tatsächlich auch umgestellt auf ein noch moderneres System, wo wir noch genauer messen können. Das ist ein videobasiertes System und mit Messplatten versehenes System, voll digital, weil wir so wahrscheinlich, das ist die Hypothese, muss ich fairerweise sagen, noch granulärer messen können, dass kleinere Unterschiede sind und die dann in Gebrechlichkeit, Vorbeuge übersetzen können.
[Nils Behrens] (23:46 - 23:55)
Einer der großen Thema sind ja die Neurodegenerativen Erkrankungen. Ihr macht ja auch eine Art von kognitiven Test. Wie läuft sowas genau ab?
[Dr. Jan K. Hennings] (23:57 - 24:09)
Neurodegenerativen Erkrankungen sind, glaube ich, insbesondere Alzheimer als demenzielles Syndrom oder demenzielle Erkrankung. Das sind Faktoren oder sind Erkrankungen, vor denen viele Menschen Angst haben.
[Nils Behrens] (24:09 - 24:11)
Ja, weil es auch mit einer Persönlichkeitsveränderung einher geht.
[Dr. Jan K. Hennings] (24:11 - 24:48)
Richtig. Genau das und die ganz häufige Frage oder Situation, was denkt meine Familie dann von mir, wenn ich Alzheimer bekomme? Was wir gesagt haben, wir gucken uns das ganz systematisch an.
Wir nehmen eine sehr gut validierte, umfangreiche neurokognitive Testbatterie. Die testet Gedächtnis, visuell und Sprachgedächtnis, Langzeit-Kurzzeitgedächtnis, tatsächlich Problemlösungsvermögen. Es geht über eine Dreiviertelstunde, muss wirklich in einem Stück absolviert werden, muss in einem ruhigen Setting absolviert werden.
[Nils Behrens] (24:48 - 24:50)
Das ist genau der Grund, warum ich ihn nicht gemacht habe.
[Dr. Jan K. Hennings] (24:51 - 25:40)
Zeit und Ruhe. Hol ihn nach, der ist wirklich wichtig, weil der Test so gut validiert ist, weil er so standardisiert ist, dass du deinen Prozentrang im Vergleich zu der Referenzgruppe, die für dich relevant ist, bekommst. Alter, Geschlecht, Ethnie.
Und dadurch kannst du sehen, wo hast du quasi Defizite, wo bist du besonders gut. Und das Entscheidende ist aber, weil es so granulär ist, kannst du auch über die Zeit kleinere Veränderungen detektieren. Das heißt, wenn du das im nächsten Jahr wiederholst und siehst, da gibt es Veränderungen in dem Bereich Kognition zum Beispiel, dann wäre das und das dann nochmal wiederholt wird, vielleicht nach 3 oder 6 Monaten, da gibt es weitere Veränderungen, minimal in die falsche Richtung, dann weißt du, müssen wir schauen, da ist was dahinter oder kann ich sogar was dafür tun, dass es besser wird, mehr Aktivität zeigen.
[Nils Behrens] (25:43 - 25:50)
Welche mentalen Parameter wie zum Beispiel HRV integriert ihr in eure Analyse, um die psychische Widerstandskraft auch zu messen?
[Dr. Jan K. Hennings] (25:50 - 26:33)
Also wir haben da zwei Dinge. Wir haben natürlich HRV als ein Stresstest, also Herzratenvariabilität als ein Stresstest integriert. Wir machen das als kurzes HRV, also über 10 Minuten oder kurzer HRV und kombinieren das ehrlicherweise mit standardisierten Fragebögen für die mentale Gesundheit.
Also wir haben GRD-7 für Ängstlichkeit, PHQ-9 für depressive Verstimmung oder IPAC, also solche standardisierten Fragebögen, die wir nutzen und bauen daraus natürlich ein Screening für mentale Gesundheit und das wird dann in dem Gespräch mit unseren Ärztinnen und Ärzten thematisiert, wenn etwas auffällig ist.
[Nils Behrens] (26:34 - 27:25)
Ich möchte ja einmal ganz kurz nur zur Sicherheit, auch wenn ich natürlich glaube, dass die meisten unserer HörerInnen mittlerweile so weit sind, dass sie auch verstanden haben, was der HRV ist, aber die Herzratenvariabilitätsmessung. Das fand ich ja, als ich ich habe tatsächlich damals auch eine kleine Ausbildung, das ist jetzt übertrieben, aber ja, für dieses Messverfahren habe ich dann einen Kursus besucht. Ich finde das ganz witzig, weil normalerweise würde ja jeder Normalsterbliche sagen, dass ein möglichst gleichmäßiger Puls eigentlich das Ziel sein muss.
Und die Herzratenvariabilität ist ja quasi diese Mikroabweichung, dann zwischen den Pulsschlägen. Und umso mehr Mikroabweichungen man da hat, umso mental gesünder oder umso stressresistenter scheint man ja zu sein. Warum ist das so?
[Dr. Jan K. Hennings] (27:28 - 28:37)
Diese Schwankungen haben wir auch zum Beispiel atemabhängig in dem Puls. Das sind Parasympathikus-Aktivität. Also das ist der Gegenspieler vom Sympathikus.
Der Sympathikus ist das, wenn wir unter Stress stehen, wenn wir kämpfen wollen. Das ist das vegetative Nervensystem. Das treibt den Puls in die Höhe und hält den Puls hoch und starr.
Der Parasympathikus, der wird immer erst eingeschaltet, wenn wir entspannt sind, wenn wir verdauen, wenn wir schlafen. Und wenn wir ein überwiegendes Sympathikus haben, dann sind wir im Stresszustand. Der Parasympathikus, wir müssen aktiv daran arbeiten, den Parasympathikus zu aktivieren, um eben diese Entspannungszustände zu bekommen.
Das kann man tatsächlich über das HRV messen. Und es gibt ehrlicherweise auch Krankheitszustände, wo das HRV stramm ist. Also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel, da gibt es dann auch wenig Variabilität drin.
Zum Teil bei Lungenerkrankungen gibt es wenig Variabilität drin. Aber es ist ein guter Marker, um zu sehen, komme ich in Entspannungszustände rein, die so wahnsinnig wichtig sind für die mentale Gesundheit und wo wir alle Probleme mit haben, die wirklich auch gut zu erreichen.
[Nils Behrens] (28:37 - 28:45)
Wie sollte denn jemand konkret vorgehen, wenn der neurodegenerative Test erste Hinweise auf beginnenden kognitiven Abhaut zeigt?
[Dr. Jan K. Hennings] (28:46 - 28:50)
Also, ich glaube, das aller-allerwichtigste ist erstmal keine Panik. Das ist immer, immer...
[Nils Behrens] (28:50 - 28:51)
Keine Panik ist immer gut.
[Dr. Jan K. Hennings] (28:51 - 29:48)
Genau. In der Medizin sowieso, aber im ganzen Leben ist keine Panik immer gut. Dann muss man einmal schauen.
Gibt es wirklich Ursachen, die dahinter stecken? Müssen wir weitere Diagnostik machen? Wie schwer sind die Veränderungen, die man da sieht?
Aber in jedem Fall kann man auch mit relativ guten allgemeinen Maßnahmen schon starten. Ernährung. Gibt es ganz gute Daten, die MIND.de zum Beispiel, dass man neurodegenerativen Verfall, demenziellen Abbau verlangsamen kann?
Das ist, wenn wir ehrlich sind, eine Form der mediterranen Diät. Wie eigentlich alle Diätformen, die was bringen. Studien evident.
Dann geht es darum, dass wir Sport machen. Ganz, ganz wichtig. Sportliche Aktivität.
Soziales Netz aktivieren. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Also keine Einsamkeit.
[Nils Behrens] (29:48 - 30:26)
Das ist ja wirklich ein ganz interessanter Punkt, weil du das nochmal so ansprichst, weil einer der erhöhten Risikofaktoren sozusagen, oder was erhöht das Risiko an Alzheimer zu erkranken, ist ja Schwerhörigkeit. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Das ist ja wirklich insofern interessant, weil du das genau ansprichst und ich hatte das damals dann auch mal hinterfragt, weil wohl tatsächlich eben halt Menschen, die schwerhörig sind, sich eben halt an so typischen Dinnergesprächen nicht mehr so beteiligen und dadurch quasi ihr Gehirn nicht mehr so fordern und wie ich ja immer sage, if you don't use it, you lose it, ist es tatsächlich einer der Probleme.
[Dr. Jan K. Hennings] (30:26 - 30:58)
Du hast weniger Input zum Verarbeiten, weil du weniger hörst und du interagierst weniger. Interagierst weniger, ganz genau. Das sind die Punkte.
Das ist wichtig. Schwerhörigkeit testen lassen. Deswegen machen wir das natürlich auch immer mit.
Soziale Aktivität, sportliche Aktivität und Kognitionsübung. Also nicht nur Apps, aber tatsächlich wirklich Denkübungen, komplexe Aufgaben lösen, auch komplexe Diskussionen führen, solche Dinge, die helfen.
[Nils Behrens] (30:59 - 31:14)
Ich finde immer wieder auch so spannend, also ich bin immer wieder geschockt, wenn es irgendwie mal um Matheaufgaben geht und ich dann irgendwie sage, ja dann ist das so und so viel. Leute gucken mich immer an. Du merkst einfach, wie wenig Menschen mittlerweile nur am Kopf rechnen.
[Dr. Jan K. Hennings] (31:15 - 31:33)
Absolut, also mich inbegriffen. Nein, aber das ist tatsächlich, es gibt ja schöne Studien, die zeigen, dass Wissenschaftler ein deutlich niedrigeres Demenzrisiko haben als die Normalbevölkerung. Unter der Hypothese, dass eben bis ins hohe Lebensalter wirklich komplexe Probleme gelöst werden.
[Nils Behrens] (31:34 - 32:26)
Sehr spannend. Aber jetzt bin ich jetzt mal gezielt auf die Frage der kognitiven Abbau gegangen. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt einmal bei euch zum Komplettcheck war, wie sehen, oder wie konkret werden denn die Empfehlungen danach, wenn man dann sein Ergebnis bekommt?
Weil ich glaube, das ist ja eine der großen Vorwürfe bei den meisten Check-up-Einrichtungen, dass man danach einen großen Berichtsband bekommt, der übliche Patient nur die Hälfte verstanden hat. Danach geht er zu seinem Hausarzt, der Hausarzt ist tierisch genervt, weil das Ganze, was irgendwie halbwegs Geld bringt, quasi schon gemacht wurde. Und das, was dann kommt, die sprechende Medizin, wird ja leider so gut wie gar nicht bezahlt.
Also von daher da steht ja meistens, ja meistens, aber sehr häufig steht dann ja der Patient mit seinem großen, schönen Berichtsmappe dann irgendwie so ein bisschen alleine dran.
[Dr. Jan K. Hennings] (32:26 - 32:33)
Das ist richtig, genau. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und dann wird das in ChatGBT hochgeladen und ChatGBT macht schon ganz gute Empfehlungen.
[Nils Behrens] (32:33 - 32:35)
Nee, das ist aber noch relativ neu.
[Dr. Jan K. Hennings] (32:35 - 33:27)
Aber man darf nicht vergessen, dass das immer noch 30% der Ergebnisse halluziniert. Etwa. Also 30% der medizinischen Empfehlungen sind Quatsch, die ChatGBT rauswirft.
Und das ist genau das, wo wir gesagt haben, wir nehmen diese Daten, integrieren die, jagen die durch unsere Analyse-Pipeline und machen dann Risikoprofile. Und zwar für alle großen altersbedingten Erkrankungen. Und du kriegst dann quasi, wir haben das Organ nach Organsystem sortiert, damit es für Patientinnen und Patienten, Klienten einfach verständlich ist.
Und dann wird aber auf der Basis der individuellen Risiken, wird dann tatsächlich ein Gesundheitsplan entwickelt. Also wo kann ich jetzt, wo muss ich jetzt intervenieren? Und wo kann ich intervenieren?
Und dann auch wie. Das hängt tatsächlich sehr vom Individuum.
[Nils Behrens] (33:28 - 33:51)
Aber ich fand es wirklich sehr interessant, also um mal aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich hatte bei euch eine körperliche Fitness, die lag 19 Jahre unter meinem chronologischen Alter. Und mein Herz wiederum war 4 Jahre älter. Da muss man ja wirklich sagen, so auf den ersten Blick macht das gar keinen Sinn.
So, weil normalerweise würde man ja immer assoziieren, jemand der sehr sportlich ist, hat auch eine gute Herzgesundheit.
[Dr. Jan K. Hennings] (33:52 - 35:14)
Aber das ist nicht der Fall. Also du hast, du bist fit, du hast ein leistungsfähiges Herz, aber du kannst natürlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, die dahinter liegen, die dann das Herzalter, das wir genutzt haben, ist auch nur ein Risikomodell, übertragen aufs Alter, erhöhen. So, und das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass wir fitte Menschen haben, die dann auf einmal ein metabolisches Risiko haben, Prädiabetes haben, Fettstoffwechselführung haben, von der sie nicht wissen, LP klein a deutlich erhöht ist.
Solche Dinge treten auf und das wäre nicht aufgefallen, wenn man nicht das systematisch untersucht hätte. Und da geht es dann natürlich darum, was kann man machen? Und dann, wenn da jemand sitzt, der sagt, ich möchte das jetzt durch den Lebensstil erstmal ändern, meine Fettstoffwechselführung oder meinen hohen Blutdruck, dann diskutieren wir das, ist das vertretbar, je nachdem wie hoch, wie stark sind die Einschränkungen oder das Risikopotenzial.
Dann versuchen wir das gemeinsam, denn das Ziel ist ja, für den jeweiligen einen personalisierten Gesundheitsplan zu entwickeln. Und wenn das nicht funktioniert, nach drei Monaten, wenn wir nachmessen und sehen, hat nicht funktioniert, dann passen wir an und dann gibt es auch Medikamente und die meisten Menschen sind dann bereit auch ein Medikament zu nehmen, auch wenn sie vorher eigentlich erstmal keins.
[Nils Behrens] (35:15 - 36:38)
Also die üblichsten Lifestyle-Interventionen sind ja ganz klar Ernährung, Bewegung, Mindset, Regeneration. Das sind ja so die vier großen Sachen. Und ich glaube, da sind sich die meisten Leute auch einig, damit kann man so 80% ungefähr so schaffen.
Die anderen 20% sind dann sehr häufig eben halt schon entweder tatsächlich, wie du sagst, entweder Medikamente, die man eben halt zum Teil nimmt, da gibt es ja auch selbst im Präventivbereich viele Leute, die Metformin, Grafamizin, auch die GLP-1-Agonisten dann eben halt nutzen. Oder aber eben halt auch tatsächlich auch das Thema Supplemente. Und da fand ich es ganz interessant, da hatte ich mal ein Gespräch mit Eric Verden, dem Leiter des Buck-Institutes, der ganz ich sage jetzt mal bullish würde man sagen, so wie das ganze Thema ist, weil er sagt, das Schöne ist, dass wenn man manchmal sieht, dass gewisse Dinge einfach bei gewissen Diagnosen sehr gut funktionieren, dass man sie auch sofort einsetzen kann im Gegensatz zu Medikamenten.
Das heißt also jemandem zu sagen, jetzt erhöhen wir mal das, also nehmen wir mal das Thema Entzündung im Körper. So, Entzündung im Körper kann man natürlich sehr gut reduzieren, indem man seine Ernährung umstellt. Teilweise auch durch Fasten.
Erst mal grundsätzlich abbauen, dann eine anti-entzündliche Ernährung, die ja meistens die mediterrane dann irgendwie ist. Und sehr häufig dann eben halt auch den Stress zu reduzieren. Das sind ja so die größten drei Faktoren, um, sage ich mal so, das Entzündung zu reduzieren.
Oder? Habe ich was vergessen?
[Dr. Jan K. Hennings] (36:38 - 36:39)
Nö, das passt schon.
[Nils Behrens] (36:41 - 36:58)
Der nächste Faktor sind aber natürlich auch Antioxidantien einzunehmen. Die kann man natürlich in Form von kiloweise Blaubeerenessen machen, kann man aber eben halt auch hochpotent durch Astaxanthin zum Beispiel oder andere anti-entzündliche Supplements nehmen. Arbeitet ihr mit sowas auch?
[Dr. Jan K. Hennings] (36:59 - 38:00)
Also ganz viele spannende Aspekte, die du gerade wieder erwähnt hast. Das ist wirklich auch komplex, wie alles in der Medizin. Das liebe ich so daran.
In diesem Kontext sehe ich Supplements tatsächlich eher wie ein Medikament. Also ich bin der Meinung, wir sollten nicht irgendwie supplementieren als Lifestyle- Intervention, sondern supplementieren, wenn wir messen und sehen, da ist ein Mangel. Und dann gibt es, klar, gibt es natürlich auch einen Raum für Supplements in unserem Konzept, ganz klar.
Aber wenn du die Antioxidantien zum Beispiel ansprichst, das ist ja nur etwas, was ich in Stanford vier Jahre lang sehr stark beforscht habe, gerade bei der Gefäßentzündung. Da ist es zum Beispiel so, dass wir reaktive Sauerstoffspezies brauchen. Reaktive Sauerstoffspezies sind ganz wichtige Signalmoleküle in den Gefäßwänden.
Und wenn wir die mit hochdosierten Antioxidantien raushauen, dann schädigen wir unsere Gefäßwände.
[Nils Behrens] (38:00 - 38:43)
Ja, das ist ganz interessant. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Also wie immer, viel bringt nicht viel, sondern die Dosis macht das Gift.
Und das ist wirklich ein Riesenfaktor, wenn du dann irgendwie die Kiloweise Vitamin C, wie es Pauling damals ja auch empfohlen hat, so der meines Wissens, glaube ich, sogar einen Nobelpreis bekommen hat. Nicht dafür, okay, fair point. Aber trotzdem, also der hat ja kiloweise dann einfach immer empfohlen, Vitamin C in absurd hohen Dosen zu machen.
Auch gegen Krebs. Und ich glaube, seine Grundidee war ja gut, aber heute weiß man halt einfach genau, was du sagst. Also ganz ohne Entzündung im Körper werden eben halt auch keine Reparaturmechanismen sozusagen in Gang gesetzt.
[Dr. Jan K. Hennings] (38:43 - 39:26)
Genau, und das ist einfach der Punkt. Also wichtig ist, und das passt in unser Konzept, und dann passen natürlich auch experimentelle Dinge und auch Supplemente rein. Wenn wir sehen, da ist ein Interventionsbedarf, und der ist messbar, und auch der Effekt ist messbar, dann kann man das machen.
Ich bin ein bisschen kritischer als Erik Werner in der Aussage, dass man mit Supplementen schnell arbeiten kann, weil da bin ich halt einfach 20 Jahre akademischer Arzt. Ich hätte gerne, und das ist auch der Leitsatz, den wir bei YEARS haben, Evidenzgrad zwei und drüber. Also wir brauchen eigentlich eine randomisierte, gut kontrollierte, doppelt verblindete Studie, um Effekt zu zeigen für Interventionen, damit wir wissen, dass es wirklich wirkt.
[Nils Behrens] (39:27 - 39:42)
Ja, wobei, das ist ja natürlich wiederum eine Sache, die weißt du besser als ich, dass alles, und letztendlich sind Supplements nichts anderes als Ernährung. Alles, was mit Ernährung zu tun hat, ist natürlich gerade da, die randomisierte Blindstudie ist wahnsinnig schwierig.
[Dr. Jan K. Hennings] (39:42 - 40:04)
Aber es gibt ja Anbieter, die sich Mühe geben, Konzentrationsangaben und hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen, wo man dann tatsächlich das auch wie ein Medikament nutzen kann, weil man weiß, was drin ist. Aber das ist ein Baustein der Komplexität des Feldes.
[Nils Behrens] (40:04 - 40:27)
Wo würdest du denn sagen, lohnt sich so eine zumindest minimal Investition in das Thema Diagnostik zu starten? Weil, also ihr habt ja verschiedene Pakete und das kleinste Paket ist ja auch das, was meines Wissens die private Krankenkasse auch übernimmt. Aber wenn jetzt einige von unseren Zuhörern jetzt einfach sagen, das klingt alles irgendwie spannend, wo würdest du denn sagen, lohnt sich es dann?
[Dr. Jan K. Hennings] (40:29 - 41:44)
Unsere Pakete sind natürlich für alle Menschen offen, es sind Selbstzahler angebotet, dass sie Teil davon sind, wird von der PKV übernommen, weil wir richtige Medizin machen einfach, ganz normale Medizin. Du auch ein richtiger Arzt bist? Und die anderen Kolleginnen und Kollegen auch natürlich.
Aber wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal einfach beim Hausarzt sagen, mach das mal, dann würde ich sagen, gibt es sicherlich sowas wie LP klein a, was viel zu selten gemessen wird, also quasi 80% dieses Wertes, Lipoprotein klein a, ein riesen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen Und sicher auch ein relativ Trägerwert ist, muss man dazu sagen. Das ist genau der Punkt. Den muss man einmal im Leben eigentlich messen als Mann, bei Frauen vielleicht zweimal, nach der Menopause.
Einmal gemessen, 80% davon sind durch Genetik bestimmt und man hat einfach das genetische Grundrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Klar. Und kann dann, gibt es wunderbare Leitlinien von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, gucken, wo stehe ich und wie muss ich meinen Lebensstil anpassen mit meinen anderen Risiken, um wirklich gesund zu sein.
Das ist eine Sache. Die andere Sache, die ich empfehlen würde, ist tatsächlich eine echte Spiroergometrie. V02max.
[Nils Behrens] (41:44 - 41:45)
Habe ich gestern gerade gemacht.
[Dr. Jan K. Hennings] (41:46 - 41:49)
Sehr gut. Willst du verraten, wie du das gemacht hast?
[Nils Behrens] (41:50 - 42:09)
Nee, es war so ein Sitzfahrrad und es ging eher um den Stoffwechselprozess. Deswegen bin ich tatsächlich nur bis 260 Watt gegangen. Also ich glaube, bei euch hatte ich 380 Watt, also deutlich mehr.
Da müsste ich nochmal reinschauen. Also Sitzrad ist dafür auch nicht unbedingt prädestiniert. Aber, also Sitzrad, du weißt, was ich meine.
[Dr. Jan K. Hennings] (42:09 - 42:10)
Ja, ja, ja.
[Nils Behrens] (42:10 - 42:41)
Wie so ein Fernsehsessel sitzt. Ja, also auf jeden Fall mit Rückenlehne. Ja, genau so.
Und es ging eigentlich eher um die Stoffwechselaktivität und ich hatte da, was ich ja so ein bisschen für mich immer irritierend und enttäuschend finde, ich hatte tatsächlich lustigerweise auch wie bei euch, glaube ich, einen V2max von 43, irgendwas. Also das habt ihr auch gemessen, während eben halt meine Variables ungefähr 10 Punkte höher sind.
[Dr. Jan K. Hennings] (42:42 - 42:55)
Wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Du bist Läufer, ne? Und dass die V02max auf dem Rad entspricht nicht deiner V02max beim Laufen.
Und dann gar nicht auf dem Sitzrad. Liegerad ist ja nur ganz freudig.
[Nils Behrens] (42:55 - 42:57)
Gibt es da überhaupt noch so Menschen, die so Liegeräder benutzen?
[Dr. Jan K. Hennings] (42:57 - 44:10)
Hab ich sehr wenig gesehen. Alles Lastenräder jetzt. Genau, also das ist aber ein wichtiger Punkt.
Also es ist trotzdem sehr, sehr sinnvoll, das einmal zu machen. Wir machen das eben auch, wie du es angesprochen hast, auf dem Rad, weil wir es dadurch standardisieren können, untereinander vergleichen, langfristig vergleichen. Aber die echte VO2max ist eigentlich so messbar, dass du wirklich für dich zugeschnitten deinen Leistungssport, den du machst, die Untersuchung machst.
Und bei Radrennfahrern dauert dann so ein Test halt auch mal anderthalb Stunden. Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Einfach aufs Rad setzen oder aufs Laufband beim Arzt mit Maske auf, V2max bestimmen.
Und das andere, ganz simpler Test, Handgriffsstärke. Warum diese beiden Teste? VO2max ist unser stärkster Prädiktor für Gesamtsterblichkeit, also wie gesund lebe ich, weil es einfach Herz, Lunge, muskuloskeletales System, Fitness betrachtet.
Und die Handgriffsstärke ist ein sehr, sehr guter Marker für muskuloskeletale Fitness und für Gebrechlichkeit. Leute, die einen starken Handgriff haben, haben viel weniger Gebrechlichkeit, assoziiert auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil sie einfach fitter sind.
[Nils Behrens] (44:11 - 44:26)
Auch da, an der Stelle, muss ich immer wieder diesen Hinweis geben, weil es bringt natürlich nichts, einen Griffkrafttrainer auf dem Schreibtisch zu legen und regelmäßig Griffkraft zu trainieren und dadurch länger zu leben, sondern es ist nur ein Indikator, der darauf hinweist, wie gut man in seiner Muskulatur sich trainiert.
[Dr. Jan K. Hennings] (44:26 - 44:29)
Ganz, ganz wichtig. Also ein Gesamt-Fitness-Indikator.
[Nils Behrens] (44:29 - 44:38)
Ja, sehr gut. Okay, habe ich verstanden. Was würdest du denn sagen, wie regelmäßig sollte man grundsätzlich so Kontrollen durchführen?
[Dr. Jan K. Hennings] (44:38 - 45:27)
Es gibt eine klare Kontextabhängigkeit. Wir müssen gucken, wenn wir was finden, wenn wir intervenieren, dann muss man das deutlich häufiger machen, als wenn man sagt, ich bin fit, ich möchte fit bleiben. Und da gibt es keine klaren Leitlinien, wollen wir auch ganz ehrlich sein.
Es gibt aber Empfehlungen, die sagen, dass man einmal im Jahr schon zumindest Blutdruck mindestens messen sollte. Wir empfehlen tatsächlich, weil das Ziel ja ist, kleine Veränderungen über die Zeit detektieren zu können, bevor ebend Symptome entstehen. Einmal im Jahr vielleicht alle zwei Jahre maximal zu kommen, einmal den gesamten Check-up zu machen, um zu gucken, wo man steht.
Um dann eben kleine Veränderungen zu finden und dann frühzeitig.
[Nils Behrens] (45:27 - 45:57)
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch, idealerweise es an der gleichen Stelle zu tun. Das muss man jetzt nicht immer bei euch machen, aber wenn man sich einmal für eine Art von Diagnostik entschieden hat, sollte man das idealerweise gleich machen, weil ich finde, du hast es gerade angesprochen, das Thema Lipoprathie klein A, ich habe das schon sehr oft in meinem Leben gemessen und habe sehr unterschiedliche Werte, weil es immer ein ganz anderes Labor war. Also schon Labore haben andere Standards und von daher ist es eben, wenn man einen Verlauf sehen möchte, ist es eben gut, dass dann auch an der gleichen Stelle den Verlauf aufgezeigt wird.
[Dr. Jan K. Hennings] (45:57 - 46:20)
Genau. Oder aber, man muss halt darauf achten, dass das wirklich nach Goldstandard-Diagnostik durchgeführt wird, weil dann sind die Werte auch gut vergleichbar im Regelfall. Deswegen alles, was wir gemacht haben, sind klinische Goldstandards, die wir integriert haben, sodass man das auch mit anderen Ärztinnen und Ärzten, anderen Unikliniken austauschen kann, diese Ergebnisse, dass die dann auch benutzt werden können. Dann kann man so natürlich auch wechseln.
[Nils Behrens] (46:21 - 46:25)
Welche Trends in der Diagnostik und Prävention siehst du in den nächsten fünf Jahren?
[Dr. Jan K. Hennings] (46:26 - 47:19)
Also ich glaube, was auf der Hand liegt, ist die Integration der künstlichen Intelligenz in der Diagnostik. Wahrscheinlich besonders bei den bildgebenden Verfahren? Absolut, da sind wir ja schon weit vorangeschritten bei der Radiologie, bei der Dermatologie.
Da gibt es ja schon wirklich gut, auch Pathologie gibt es schon wirklich hohe Erfolgsraten. Die sind zum Teil besser und genauer als Radiologen, die Systeme, die es da gibt. Aber auch bei der Integration von Befunden, gerade wenn man komplexere Befunde hat und bei der Therapie-Guidance.
Und, und das ist das, was ich auch sehe, die Integration von Multi-Omic-Analysen, also systembiologische Analysen von verschiedenen Systemen des Körpers, zusammengeführt mit KI, sind sicherlich Trends, die wir in den nächsten fünf Jahren sehen werden.
[Nils Behrens] (47:19 - 47:20)
Kannst du die Multi-Omic erklären?
[Dr. Jan K. Hennings] (47:20 - 48:24)
Also, Omics bedeutet, dass wir uns bestimmte Körpersysteme auf Systemebene angucken, Biologie des Körpers auf Systemebene angucken.
Also wenn wir Blut nehmen und uns da alle Eiweiße, alle Proteine dran angucken, dann haben wir das Blutproteom. Oder wenn wir uns alle Stoffwechselprodukte angucken, dann haben wir das Metabolom. Und diese Ome, Omics, zusammengefügt, das kann man auch zum Beispiel mit allen Radiologiebildern machen.
Das ist das Radium oder mit den klinischen Daten, die man aus der Gesundheitsakte hat. Das ist das Klinom, häufig so genannt. Das sind also dann zusammengesetzt Multi-Omics.
Und das sind sehr, sehr komplexe Datensätze mit sehr vielen Daten. Und die zu analysieren und daraus Sinn zu ergeben, Netzwerkanalysen durchzuführen, dafür braucht man KI. Dafür kann KI wirklich was bringen, weil es die Komplexität reduziert und die Interpretation deutlich erleichtern kann.
[Nils Behrens] (48:25 - 48:42)
Verstanden. Was würdest du sagen, hast du in deiner Zeit jetzt bei YEARS schon ein spannendes Beispiel aus der Praxis, wo ihr vielleicht was entdeckt habt, was vielleicht sonst in ein größeres Problem geendet hätte? Oder wo ihr vielleicht auch das Leben von jemandem verändert habt?
[Dr. Jan K. Hennings] (48:42 - 50:23)
Wir haben tatsächlich schon in der kurzen Zeit, in der wir jetzt seit letztem Oktober offen sind, erstaunlicherweise bei relativ vielen Menschen was gefunden. Eigentlich finden wir bei fast jedem was. Wichtig ist nur natürlich, das auch einzuordnen.
Nur wenn man was findet, heißt das nicht, dass es auch krankhaft ist. Und man muss auch in jedem Fall nicht direkt was machen. Man muss es nur wissen.
Ja, es gibt ganz viele Fälle, wobei ich mir immer so ein bisschen gegen Fallbeispiele wehre, weil das eben natürlich auch nur Hinweise sind und keine hohe Evidenz sind. Aber wir haben Fälle, wo, das hatte ich vorhin schon angesprochen, Leistungsträger, Managertyp, topfit, trotzdem hohes Herz-Kreislauf-Risiko. Wir haben Fälle gehabt, 80-jährige Dame, die abgeschlagen ist, Ausschläge hatte, Urticaria, Nesselsucht und nach Anstrengung immer so Crashes hatte und dann einfach tagelang nicht mehr auf die Beine kam.
Da hat man dann herausgefunden, dass sie eine sehr, sehr seltene, mit dem klassischen Allergie-Test nicht detektierbar Form einer Glutenunverträglichkeit hat. Und die ist jetzt unter sehr strikt glutenfreier Diät, und das sage ich als Pneumologe, ist die tatsächlich beschwerdefrei. Wir haben Fälle aber auch leider, wo wir Hinweise auf Krebsarten detektiert haben, schon, die dann weiter abgeklärt wurden.
Also wir haben tatsächlich schon relativ viele relevante Befunde erheben können.
[Nils Behrens] (50:24 - 50:41)
Also wenn wir jetzt mal so reiterieren, nennt das ja immer die apokalyptischen Reiter. Da haben wir den ersten Reiter eben halt Diabetes, das hast du angesprochen, da gibt es ja einige Blutwerte, die ein gutes Früherkennungs-Diät Thema sind. Das heißt also, das ist einmal, also Hb1c kann man tatsächlich als Diagnostikum nutzen.
[Dr. Jan K. Hennings] (50:41 - 50:42)
Also das ist Langzeit-Blutzucker.
[Nils Behrens] (50:43 - 50:46)
Hb1c, ich finde auch den HOMA-Index in dem Zusammenhang auch mal sehr gut.
[Dr. Jan K. Hennings] (50:48 - 51:24)
Insulinresistenz sozusagen. Was man auch machen kann, ist natürlich der nüchternen Blutzucker. Und was wir machen, ist der orale Glucosetoleranz-Test bei jedem Patienten.
Das heißt also nüchtern zu uns kommen, eine definierte Menge Zucker trinken, und dann wird im Blut gemessen nach einer Stunde, nach zwei Stunden. Und dann schaut man, wie der ansteigt. Das ist etwas, was auch empfohlen ist.
Für die Diagnostik des Prä-Diabetes reicht aber zum Screening wahrscheinlich sogar der Hb1c aus. Muss man fairerweise sagen. Wir wollen natürlich genauer wissen, wie es ist.
Also metabolisches Risiko, Herz-Kreislauf-Risiko.
[Nils Behrens] (51:24 - 51:42)
So, wir haben jetzt also das Thema Diabetes sozusagen als Reiter Nummer 1. Als Reiter Nummer 2 ist eben das Thema Herz-Kreislauf- Erkrankung. Das mache ich eben halt zum einen eben halt auch über gewisse Blutmarker, sage ich mal so.
Also da spielen ja die Blutfette auch eben halt häufig eine Rolle.
[Dr. Jan K. Hennings] (51:42 - 51:51)
Absolut, genau. Also Blutfette muss man bestimmen, Gesamtcholesterin, HDL, LDL, LP klein A, wenn nicht gemacht. Ich kann das immer noch wieder sagen, noch einmal messen.
Ganz wichtig.
[Nils Behrens] (51:51 - 51:53)
Und natürlich dann Ultraschall.
[Dr. Jan K. Hennings] (51:53 - 52:14)
Ultraschall des Herzens, EKG.
Und zwar in Ruhe unter Belastung. Das ist wichtig, weil wir viele, viele Veränderungen in Ruhe nicht sehen und die sich erst unter maximaler Anstrengung demarkieren. Deswegen machen wir auch die Spiroergometrie und dann sich gegebenenfalls da noch eine weitere Bildgebung anschließt.
Aber das muss man zum Screening auf jeden Fall machen.
[Nils Behrens] (52:14 - 52:38)
Das ist ganz wichtig. Das ist der Reiter Nummer 2. Der Reiter Nummer 3 ist eben halt das ganze Thema Alzheimer oder Demenz, sage ich mal so.
Und natürlich in weitestem Sinne auch Parkinson. Also Neurodegenerativen Erkrankung. Wobei, aber ich glaube, seine Reiter sind tatsächlich, sein Reiter ist nur der Demenzreiter, wenn ich mir nicht ganz sicher bin.
Aber über Parkinson-Diagnostik haben wir ja schon ganz kurz gesprochen. Und da würde sich eben halt dieser kognitive Leistungstest empfehlen.
[Dr. Jan K. Hennings] (52:39 - 52:39)
Absolut.
[Nils Behrens] (52:40 - 52:49)
Dreiviertelstunde, der lohnt sich, der macht sogar Spaß. Gegebenenfalls eben halt sich die Gene in diesem Zusammenhang ruhig noch einmal anschauen, um zu schauen, ob vielleicht ein erhöhtes Risiko vorliegt.
[Dr. Jan K. Hennings] (52:49 - 52:57)
Das ist schon advanced. Also wenn du sagst, was würde ich jetzt konkret machen, was ist auch umsetzbar, dann sind das tatsächlich Blutentnahme...
[Nils Behrens] (52:58 - 53:09)
So, und jetzt der letzte Reiter ist ja dann das Thema Krebs. Da haben wir ja jetzt schon mal über das Thema Früherkennung gesprochen, aber wie wollen wir jetzt sozusagen diesem Reiter auf die Spur kommen?
[Dr. Jan K. Hennings] (53:10 - 54:22)
Genau, also die wichtigste, der wichtigste Ansatz da ist sicherlich die Krebsvorsorge, wo wir wissen, dass sie was bringt, und die empfohlen ist. Also Koloskopie ab 50, wenn ich ein familiäres Risiko habe für Darmkrebs früher. Zum Hautarzt gehen, die Leberflecke angucken, jährlich ehrlicherweise bieten wir tatsächlich bei uns auch mit an.
Dann zur Frauenärztin gehen, Brustkrebsvorsorge machen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die sollte man wahrnehmen, ganz wichtig. Weniger hohen Stellenwert, das ist tatsächlich, geht es in den experimentellen Bereich, das ist, muss nicht jeder machen, das sollte jeder machen, jeder, jeder, jeder.
Ja. Dann geht es in den experimentellen Bereich, dann geht es dann darum, kann man eine Flüssigbiopsie mal machen und versuchen, wo man da steht, da kann man ein spezifisches MRT machen, wenn es eine Indikation gibt, da kann man ein Ganzkörper-MRT versuchen, aber eben unter den ganzen Einschränkungen, die ich vorhin genannt habe. Nur die Angebote, die es gibt bei Rauchern, das Lungenkrebs-Screening mit CT, die sollte man wirklich nutzen, das ist ganz wichtig.
[Nils Behrens] (54:23 - 54:38)
Sehr gut, sehr gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage, das ist eigentlich die Frage, mit der ich auch gestartet bin, du hast ja gesagt, dein letzter Sonntag war nicht so gesund, wenn du den perfekten Sonntag gestalten würdest, körperlich, geistig, diagnostisch, wie sähe der denn aus?
[Dr. Jan K. Hennings] (54:39 - 55:51)
Der wäre wahrscheinlich so, dass ich ausschlafen würde, also mein ausreichend Schlaf hätte, dann würde ich den, der Sonntag wäre kein Leistungssonntag, der perfekte Sonntag, sondern der perfekte Sonntag wäre ein sehr balancierter Sonntag. Ausreichend Schlaf, gutes, balanciertes Frühstück, ballaststoffreich, mit der Familie, in Ruhe, keine Screens, ein bisschen Bewegung, Zone 2, dass man das gute Gefühl bekommt, nach dem Sport, aber nicht ausgepowert ist, sich nicht gepusht hat mal, sondern wirklich mal ein bisschen an der frischen Luft, in der schönen Umgebung, soziale Interaktion, was spielen, wirklich mal versuchen, einen Screen-freien Sonntag zu machen, was so schwer ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wir sind alle abhängig von unseren Bildschirmen. Ein bisschen Besinnung, mal irgendwie reflektieren, ein bisschen Zeit für sich haben, dankbar sein, machen wir auch viel zu wenig, viel zu wenig, ja und dann ein leichtes Abendessen und früh ins Bett.
[Nils Behrens] (55:51 - 56:10)
Ausgezeichnet. Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Und zum Thema Dankbarkeit, ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wenn ihr mehr erfahren wollt zu Jan, beziehungsweise dem Programm, könnt ihr unter years.co mal schauen, wir packen das auch noch mal in die Shownotes und ich glaube, ich weiß jetzt genau, was ich als nächstes tun muss. Super, das freut mich sehr.
[Dr. Jan K. Hennings] (56:11 - 56:11)
Vielen Dank.
[Nils Behrens] (56:14 - 56:16)
Hast du eigentlich ein Lieblingssupplement?
[Dr. Jan K. Hennings] (56:17 - 57:01)
Ich hab's vorhin schon gesagt, ich sehe Supplements nicht so als Lifestyle Add-on, die Hebel sind für mich andere, aber wenn irgendwo ein Defizit ist, dann ersetze, was ersetzt werden muss. Ich bin kein Freund, so wie ich keine Medikamente einnehme, ohne Sinn auch Supplements einzunehmen.
Die Ernährung optimieren ist, glaube ich, sehr komplex und jeder soll machen, was er mag. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich hab keinen Supplement.
Ich nutze das wie ein Medikament.
[Nils Behrens] (57:02 - 57:27)
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast.
Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabatt Code gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter